|
In
meiner gesamten Kindheit und Jugendzeit war das Radio unser ständiger
Begleiter während des ganzen Tages. Als ich mit etwa zwölf Jahren
einige Monate wegen einer schweren Gelenkentzündung in der Kinderklinik
Neunkirchen-Kohlhof verbringen musste, hatte ich das große Glück, dass
mir die liebe
Schwester Agnes eines Tages ihr privates kleines Radio von zu Hause
mitbrachte und auf meinen Nachttisch stellte. So konnte ich von da an
in meinem Krankenbett den Märchenonkel hören und natürlich auch viel Musik!
Wir hatten sogar ein gemeinsames Lieblingslied: "Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere..."
(von Peter Alexander und Leila Negra), das damals gerade neu
herausgekommen war und oft im Radio gespielt wurde.
Zu jener Zeit gab es am Morgen und am Nachmittag noch recht lange Sendepausen im Radio; sie dauerten jeweils
zwei bis drei Stunden. Dann wartete ich in meinem Krankenbett immer mit Spannung
auf den erneuten Sendebeginn morgens um 11 Uhr bzw. nachmittags um vier oder fünf. Etwa zehn Minuten vorher begann immer das wiederholte Abspielen des
Pausenzeichens. Bei Radio Saarbrücken wurden dafür bis 1956 die ersten acht Töne
des Volksliedes "Kein schöner Land in dieser Zeit" gespielt, das ich
schon von meiner Mutter und aus der Schule kannte.
Pausenzeichen von Radio Saarbrücken: Zum Anhören bitte hier auf den Lautsprecher und dann auf
"Öffnen" klicken! > 
(Infos über die verschiedenen Pausenzeichen des Saarbrücker Senders: Siehe Seite Radio Saarbrücken 1, Abschnitt 9) Pausenzeichen).
Dann
endlich kam die Ansage:
"Hier ist Radio Saarbrücken. Guten Morgen, liebe Hörer, wir setzen nun
unser Programm fort." Danach folgte eine Programmvorschau, und nun
begannen die Sendungen. Die morgendliche Sendepause wurde erst ab 1963
ausgefüllt, und zwar durch die damals neue Sendung "90 Bunte
Funkminuten" mit Klaus Groth.
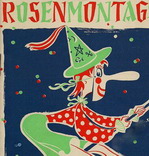 Aber schon lange vorher fiel in den 50er-Jahren einmal die Sendepause aus. Und das kam so: Es war am Rosenmontag
1958 oder 1959. Radio Saarbrücken sendete schon den
ganzen Morgen fröhliche Fastnachtsmusik, und viele Hörer meldeten sich
telefonisch im Funkhaus, um sich dafür zu bedanken: "Tolle Musik
- macht weiter so!" Ernst Becker erzählte mir, dass er an diesem Tag
Dienst in der Tontechnik hatte und sich mit seinen Kollegen über die positive Resonanz zu ihrem Programm freute. Der LvD (Leiter vom Dienst) Alfred Zerndt (siehe Foto auf Seite Radio Saarbrücken im Abschnitt 15b) saß
in der Ton-Regie an den Reglern. Bald stand die nachmittägliche
Sendepause von 14:30 bis 17 Uhr bevor. Von der Sendeleitung war wohl
schon niemand mehr im Haus, als sie plötzlich auf eine verrückte Idee
kamen. Der LvD telefonierte mit den Kollegen in Heusweiler und wies sie
an, den Sender heute um halb drei nicht abzuschalten, denn es
werde "durchgesendet"! Das hatte es zwar noch nie gegeben, aber die
Männer in Heusweiler machten mit. Und in
der Wartburg legten die Techniker nun auch noch nach 14:30 Uhr non stop
Karnevalslieder ohne jede Ansage auf - und die eigentlich
vorgeschriebene Sendepause fiel einfach aus! Begeisterte Höreranrufe
kamen im Funkhaus an, und so sendeten sie fröhlich weiter. Als sie die
Platte "Der Lachende Vagabund" von Fred Bertelsmann spielten,
versammelten sie sich im Sprecherraum vor dem Mikrofon und lachten über
den Sender mit. Aber schon lange vorher fiel in den 50er-Jahren einmal die Sendepause aus. Und das kam so: Es war am Rosenmontag
1958 oder 1959. Radio Saarbrücken sendete schon den
ganzen Morgen fröhliche Fastnachtsmusik, und viele Hörer meldeten sich
telefonisch im Funkhaus, um sich dafür zu bedanken: "Tolle Musik
- macht weiter so!" Ernst Becker erzählte mir, dass er an diesem Tag
Dienst in der Tontechnik hatte und sich mit seinen Kollegen über die positive Resonanz zu ihrem Programm freute. Der LvD (Leiter vom Dienst) Alfred Zerndt (siehe Foto auf Seite Radio Saarbrücken im Abschnitt 15b) saß
in der Ton-Regie an den Reglern. Bald stand die nachmittägliche
Sendepause von 14:30 bis 17 Uhr bevor. Von der Sendeleitung war wohl
schon niemand mehr im Haus, als sie plötzlich auf eine verrückte Idee
kamen. Der LvD telefonierte mit den Kollegen in Heusweiler und wies sie
an, den Sender heute um halb drei nicht abzuschalten, denn es
werde "durchgesendet"! Das hatte es zwar noch nie gegeben, aber die
Männer in Heusweiler machten mit. Und in
der Wartburg legten die Techniker nun auch noch nach 14:30 Uhr non stop
Karnevalslieder ohne jede Ansage auf - und die eigentlich
vorgeschriebene Sendepause fiel einfach aus! Begeisterte Höreranrufe
kamen im Funkhaus an, und so sendeten sie fröhlich weiter. Als sie die
Platte "Der Lachende Vagabund" von Fred Bertelsmann spielten,
versammelten sie sich im Sprecherraum vor dem Mikrofon und lachten über
den Sender mit.
So
ging es weiter, bis um 17 Uhr das reguläre Nachmittagsprogramm mit dem
"Angelus" [1]
wieder begann. Kurz vorher kam der damalige Unterhaltungschef Rudi
Schmitthenner ins Funkhaus und fragte fassungslos: Was macht ihr denn
da??? Und natürlich kassierten sie später eine heftige Rüge vom
technischen Direktor des Senders, Ferdinand Glasow
(der schon seit 1949 bei Radio Saarbrücken war). Sie konnten froh sein,
dass sie nicht auch noch für die zusätzlichen
Stromkosten aufkommen mussten, die ihr Alleingang verursacht hatte.
Aber in den darauffolgenden Jahren stand am Rosenmontag Nachmittag auch
offiziell keine Sendepause mehr im Programm...
[1]
zum "Angelus": siehe unsere Seite Radio Saarbrücken ganz unten im Abschnitt16) unter Punkt 3)
|
In den 50er-Jahren gab es anfangs ja noch kein Fernsehen. Und als 1954 die Privatstation „Telesaar“ zu
senden begann, konnten wir uns noch kein TV-Gerät leisten. So hörten wir abends
weiterhin mit der ganzen Familie Radio Saarbrücken. Dort liefen zum
Beispiel an einem bestimmten Tag in der Woche die bekanntesten und
beliebtesten Musikstücke
im Wunschkonzert mit Paul Heinen (es hieß "Sie wünschen - wir spielen"). Die Hörer konnten sich per Postkarte ihren
Lieblingstitel wünschen, und dann hörten wir auf unserem Sender z.B. Lieder und
Schlager von Vico Torriani, René Carol, Friedel Hensch und den Cypries, Freddy
Quinn, Wolfgang Sauer, Caterina Valente usw., aber auch kurze klassische Stücke wie die Ouvertüre zu Franz von Suppés "Leichter Kavallerie" oder das
Zwischenspiel aus Notre Dame von Franz Schmidt, das meine Mutti so gerne hörte.
|

Paul Heinen
|
|
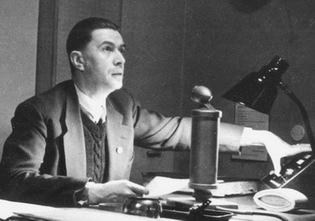
|
Ende der fünfziger
Jahre hieß die Sendung "Vom Telefon zum Mikrofon"; sie wurde von Rudi
Schmitthenner moderiert. Das Besondere daran war, dass sich die Hörer durch
einen Anruf im Funkhaus einen Titel wünschen konnten, der dann bereits nach
wenigen Minuten gesendet wurde - der Weg vom Schallarchiv zum Sendestudio ist in
der Wartburg wohl nicht allzu weit gewesen*).
Meine schon etwas ältere Tante
Paula hatte das System nicht verstanden. Einmal fragte sie erstaunt:
"Wie
kommt es nur, dass sie dort immer so schnell die Noten zu den
gewünschten Stücken bereit liegen haben?" Ihre Kenntnisse der
Rundfunktechnik bezogen sich wohl auf den Stand der 30er- und
40er-Jahre, als die Musik tatsächlich noch immer nur von den
sendereigenen Orchestern gespielt und live über die Sender zu hören
war. Dass aber jetzt die fleißigen
Radioleute beim Wunschkonzert die passende Schallplatte in Windeseile
vom Archiv zum Studio
brachten, um sie dort schon wenige Minuten nach dem Höreranruf
abzuspielen, das
mussten wir unserer lieben Tante erst mal erklären.
|
|
Das Bild oben (Foto: SR/Werner Dorow) zeigt Rudi Schmitthenner, der damals der Unterhaltungs-Chef von Radio Saarbrücken war.
Der
damalige Toningenieur Ernst Becker erinnert sich, dass während dieses
Telefon-Wunschkonzerts immer zwei bis drei Leute zwischen dem
Sendestudio und dem Schallarchiv, das sich ebenerdig im Hofraum der
Wartburg befand, hin- und herflitzten, um die gesuchten Platten
möglichst schnell ins Studio zu bringen.
Das Programm der Rundfunksender war früher die ganze
Woche über an ein festes Schema gebunden. Auch das von Radio Saarbrücken. Musik-
und reine Wortsendungen waren meist voneinander getrennt. Einige Sendungen
wurden täglich, andere nur an bestimmten Tagen ausgestrahlt. Für jede Zielgruppe
unter den Hörern gab es Programme, die sich immer an denselben Wochentagen zu
festgelegten Zeiten an sie richteten. So wusste der Zuhörer immer genau, wann er
die von ihm bevorzugten Sendungen hören konnte. Die Nachrichten
kamen aber noch lange nicht zu jeder Stunde und auch nicht immer zur vollen
Stunde (wie heute), sondern auch mal um viertel vor oder um 20 nach.
Sie begannen immer mit einem Gongschlag, der Zeitangabe und der Ansage
"Radio Saarbrücken. Sie hören Nachrichten." Danach folgte (zumindest
nach etwa 1956) sehr oft das Wort "Bonn.", weil die erste Meldung meist
aus der damaligen Bundeshauptstadt kam. Abends konnte man
ausführlichere
Berichte und Kommentare aus dem Saarland, Deutschland, Frankreich und
der übrigen Welt in der Stimme des Tages hören. Sie hatte als Zusammenfassung des politischen Tagesgeschehens ihren
festen Platz im Programm und kam immer um 19:45 Uhr.
Mehr über Nachrichten und Stimme des Tages finden Sie hier auf unserer Seite Radio Saarbrücken.
|
|

|
Auch
bestimmte Spartensendungen konnte man täglich zu festen Uhrzeiten
hören: Kulturspiegel, Kinderfunk, Schulfunk, Landfunk usw. Es gab sogar
einen besonderen "Frauenfunk". Außerdem - natürlich - an jedem Werktag
mindestens einen Französischkurs.
Dies war in der Saarstaat-Zeit sehr wichtig im Sinne der „pénétration culturelle de la Sarre“.
Täglich bis zu viermal (!) wurden Kirchenfunksendungen angeboten, und dazu kam immer sonntags morgens die
Direktübertragung eines vollständigen katholischen oder evangelischen
Gottesdienstes aus einer saarlän- dischen Gemeinde, meist aus Saarbrücken, häufig
auch aus St. Ingbert oder anderen Orten.
Das Foto zeigt Christa Adomeit († 2017), eine über viele Jahrzehnte hinweg sehr beliebte Sprecherin bei Radio Saarbrücken. Später moderierte sie etwa zehn Jahre lang die beliebte Hörfunksendung
"Morgengruß der Saarlandwelle". Sie war mit dem Sprecher O.K. Müller verheiratet. (Foto: Christa Müller-Adomeit)
|
|
In unserer Familie hörten wir auf Radio Saarbrücken aber viel lieber andere Programme, z.B. die tollen Hörspiele!
Einige waren lustig („Mundartbühne“) und andere spannend
(„Hörspielkrimis“). In den frühen Jahren wurden sie live aus den
Hörspielstudios des Funkhauses in der Wartburg übertragen; später hat man sie
dort vorproduziert und dann vom
Band gesendet. Oft erkannten wir die Stimmen von Sprechern, die tagsüber
auch in den anderen Sendungen zu hören waren, z.B. diejenigen von Maria Ruhmann, Brigitte
Dryander, den Weissenbachs oder Günter Stutz. Als Spielleiter sind mir Viktor Lenz und A.C.
Weiland im Gedächtnis geblieben.
An einem bestimmten Wochentag, ich glaube donnerstags, besuchten unsere Eltern einige Jahre lang das Neunkirchener
Eden-Kino. Sie gingen dann immer so gegen acht Uhr aus dem Haus, und wir Kinder
blieben alleine. Bevor wir ins Bett krochen, durften wir noch eine Stunde lang
Radio hören; aber ja nicht das Krimi-Hörspiel, das immer gerade an diesem Wochentag über Radio Saarbrücken lief! Wir sollten
stattdessen den Südwestfunk einschalten, oder Frankfurt oder Stuttgart... Doch wie sehr
mussten wir uns jedes Mal am nächsten Morgen beherrschen, um uns nicht zu
verraten und unsere verbotenen und deshalb doppelt so aufregenden
Hörspielkrimi-Erlebnisse vom Vorabend preiszugeben.
|
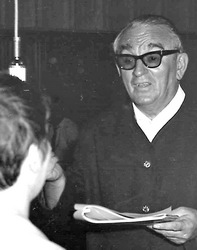
Viktor Lenz, Hörspielleiter
(Foto: Ernst Becker)
|
|
Werktags warf uns am frühen Morgen immer Ferdi
Welter aus dem Bett. "Guten Morgen, liebe Hörer", hieß seine
Sendung, und damit die
Leute pünktlich zur Arbeit gingen, musste er laufend die genaue Zeit
ansagen –
was sonst am Tag meist nur zur vollen Stunde geschah. Er aber schlug
den Gong auch oft mitten in seiner Sendung, um die gerade vollendete
Minute zu verkünden:
„Beim Gongschlag war es 6 Uhr 34“. Eines Tages wurde ihm diese Praxis
von der
Sendeleitung aber untersagt. Doch er hatte schnell Abhilfe gefunden: Er
verwendete nun statt des Gongs ein kleines Handglöckchen. (> Mehr zum Gong)
Die Musikstücke, die man damals auf unserem
Sender hören konnte, waren in verschiedene Sparten aufgeteilt: Volkslieder,
Schlager- und Tanzmusik sowie klassische Stücke wurden meist in getrennten Sendungen
dargeboten. Samstags lauschten wir oft einem öffentlichen „Bunten Abend“, der -
natürlich live - aus dem Großen Sendesaal in der Saarbrücker Wartburg übertragen
wurde. Dabei spielten die Rundfunkorchester auf, z.B. das Tanzorchester unter Edmund
Kasper oder Manfred Minnich, und es sangen bekannte Schlagerstars, die meist
aus der Bundesrepublik angereist waren. Sonntags wurden
die
beliebten Sinfonie-Konzerte aus der Salle Pleyel in Paris übernommen -
für klassische Musik gab es ja noch kein eigenes Programm (wie später
SR2 bzw. Studiowelle).
|
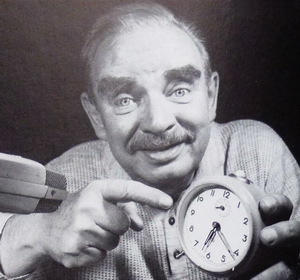
Ferdi Welter verkündete in seiner Frühmorgensendung alle paar Minuten die Uhrzeit. (Foto: SR)
|
|
Sonntags nachmittags lief von viertel nach fünf bis um sechs die Sendung "Sport und Musik". Moderator war in den 50er-Jahren meist Franz Duhr.
Bevor er die richtige Tippreihe im Fußball-Toto durchgab, sagte er fast
immer: "So, Oma, holl die Brill, die Tippzahle komme!"Hier können Sie sich seine Stimme noch einmal in Erinnerung rufen
Zum Anhören bitte klicken>  (leider etwas übersteuert) (leider etwas übersteuert)
Die Titelmelodie dieser Sport-Sendung war lange Zeit das gleichnamige Musikstück "Sport und Musik" (von 1951, gespielt vom RIAS Tanzorchester
unter Werner Müller):

In späterer Zeit wurden die Sportsendungen von Hans Berwanger, danach von Werner Zimmer und weiteren Sportmoderatoren gestaltet.
Zum Foto: Franz Duhr moderierte Sportsendungen nicht nur im Radio, sondern auch bei TELESAAR. Das Bild entstand im Fernsehstudio Richard-Wagner-Straße etwa 1958
(Foto: Sammlung Hans-Günter Quirin).
|
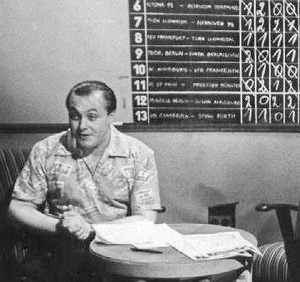
|
|
Eine Unterbrechung des laufenden Programms, um
aktuelle Meldungen sofort zu übermitteln, wenn etwas "passiert" war - das war damals bei Radio Saarbrücken
(ebenso wie bei den anderen deutschen Sendern) noch undenkbar. Erst nachdem man
die Sendestruktur des ersten SR-Hörfunkprogramms 1964 umgestellt hatte, wurden
brisante Meldungen auf der neuen „Europawelle Saar“ mit einem Jingle
angekündigt und ins laufende Programm eingestreut: "SR1 - Aktueller
Dienst".
In der Zeit davor gab es so etwas im Saar-Radio
nicht. Die französische Station Europe No. 1,
die auf Langwelle sendete, war in dieser Beziehung wesentlich
fortschrittlicher. Manche Saarländer schalteten ab und zu gerne auf diesen Sender um, vor allem wegen der flotteren  Musik.
Eines Morgens (es
war der 9. Oktober 1958) hörte ich dort plötzlich
die Nachricht: "Le Pape est mort", und die Musik wurde „getragener“. Papst
Pius XII. war in Castelgandolfo gestorben. Als ich schnell auf Radio
Saarbrücken umschaltete, stellte ich erstaunt fest, dass dort das übliche
Programm mit heiterer Musik ganz normal weiterlief. Es dauerte noch eine halbe
Ewigkeit - wohl fast eine Stunde - bis die laufende Sendung plötzlich und
unvermittelt abgebrochen wurde. Nun hörte man mehrere Male das Pausenzeichen,
und danach für eine geraume Zeit nur schwere Orgelmusik. Eine Ansage mit einer
Begründung dafür erfolgte zunächst immer noch nicht. Erst zur vollen Stunde, als die
regulären Nachrichten begannen, erfuhren auch die Hörer von Radio Saarbrücken,
dass der Papst gestorben war. Man hatte wohl so lange gebraucht, um sich auf
die Umstellung des Programms vorzubereiten. Wahrscheinlich waren zunächst gar
keine Nachrichtenleute im Funkhaus gewesen. Musik.
Eines Morgens (es
war der 9. Oktober 1958) hörte ich dort plötzlich
die Nachricht: "Le Pape est mort", und die Musik wurde „getragener“. Papst
Pius XII. war in Castelgandolfo gestorben. Als ich schnell auf Radio
Saarbrücken umschaltete, stellte ich erstaunt fest, dass dort das übliche
Programm mit heiterer Musik ganz normal weiterlief. Es dauerte noch eine halbe
Ewigkeit - wohl fast eine Stunde - bis die laufende Sendung plötzlich und
unvermittelt abgebrochen wurde. Nun hörte man mehrere Male das Pausenzeichen,
und danach für eine geraume Zeit nur schwere Orgelmusik. Eine Ansage mit einer
Begründung dafür erfolgte zunächst immer noch nicht. Erst zur vollen Stunde, als die
regulären Nachrichten begannen, erfuhren auch die Hörer von Radio Saarbrücken,
dass der Papst gestorben war. Man hatte wohl so lange gebraucht, um sich auf
die Umstellung des Programms vorzubereiten. Wahrscheinlich waren zunächst gar
keine Nachrichtenleute im Funkhaus gewesen.
Inzwischen sieht es seit vielen Jahren damit beim SR in dieser Beziehung natürlich ganz anders aus.
Der Privatsender Europe No. 1 verfügte dagegen offensichtlich schon in den
50ern über einen echten und gut funktionierenden "Aktuellen
Dienst"...
|
|

|
Jeden Sonntag um 13 Uhr lief auf unserem
Heimatsender Radio Saarbrücken eine Sendung namens "Saarlandbrille".
De Zick (Fritz Weissenbach), de Zack (Peter
Schmidt) unn es Marieche (Maria Ruhmann) glossierten in einem Gemisch
aus
Hochdeutsch "mit Striefen drein" und Mundart verschiedene Themen aus
dem politischen, kulturellen und gesellschaft- lichen Leben, die in der
Woche zuvor im Land eine Rolle gespielt hatten. Sie erzählten häufig
auch von einem „Herrn Nieselpriem“, der meist sehr seltsame Ansichten
hatte.
Für mich war diese
Sendung einige Jahre lag im wahrsten Sinne des
Wortes ein echter "Wegbegleiter":
Sonntags ging ich in Neunkirchen als Zwölf- bis Vierzehn-Jähriger häufig nach dem Mittagessen
zu Fuß von unserer Wohnung unten am Hüttenberg bis zur Willi-Graf-Straße, um
bei einem Freund spielend den Nachmittag zu verbringen. In der wärmeren
Jahreszeit konnte ich auf meinem Weg dorthin aus den geöffneten Fenstern fast aller
Häuser, an denen ich vorbeiging, praktisch lückenlos die "Saarlandbrille"
mitverfolgen – von einem Haus zum anderen. Wenn das kein Beweis für die Beliebtheit der
Sendung war!
|
Mehr über diese sonntägliche Sendung (auch mit einem Originalton zum Anhören): siehe unsere Sonderseite zur "Saarlandbrille".
Das Bild oben zeigt v.l.n.r.: de Zack (Peter
Schmidt), 's Marieche (Maria Ruhmann) unn de Zick (Fritz Weissenbach).

Aber
nicht nur die vielen regulären Sendungen waren bei den Hörern sehr
beliebt. Auch so manche Werbeeinblendung gehörte dazu. Radio
Saarbrücken hatte
als zweite deutschsprachige Radiostation am 8. August 1948
Werbefunk-Sendungen
ins Programm aufgenommen. Am selben Tag erhöhte man die Sendeleistung des Heusweiler Mittelwellen-Senders von vorher 2 kW auf
20 kW. Die Wirkung der ersten Reklamesendungen von Radio Saarbrücken soll
umwerfend gewesen sein: Bei einigen Firmen stieg der Umsatz unmittelbar nach Beginn ihrer
Werbeausstrahlungen im Radio auf das Doppelte an; andere sollen mit der Produktion ihrer Waren nicht mehr nachgekommen sein (siehe dazu auch unsere Seite Radio Saarbrücken im Punkt
6: "Der Werbefunk von Radio Saarbrücken hieß "Radio-Reklame").
Ich erinnnere mich auch noch an einige andere regelmäßige kurze Werbefunk-Sendungen. Eine hieß "Dop und Döpchen". Es war
eine Art Comic-Serie für Kinder und Erwachsene. So etwas ließen wir uns an
keinem Tag entgehen! Werner Wiedemann
(siehe Foto, er war der "Dop") und ein kleiner Junge (das "Döpchen") spielten kurze lustige Szenen und machten dabei Werbung für ein damals
auch im Saarland erhältliches französisches Haarwaschmittel,
"Shampoing DOP", nach dem die beiden ja auch ihre Namen erhalten hatten. Auch Hildegard Puth gestaltete mehrmals in der Woche kurze regelmäßige Sendungen mit Tipps für die Hausfrau. Unter diesem Link können Sie sich zwei ihrer Sendungen anhören, deren Aufnahmen durch einen großen Glücksfall erhalten geblieben sind!
Das Bild oben zeigt Werner Wiedemann in den frühen 50er-Jahren. Er war in zahlreichen Sendungen der Radioreklame zu hören.
(Foto: Landesarchiv Sbr., Weißenbach-83)
|