|
oben
|
|
Vorweg
einige gebräuchliche Begriffe aus der Welt der
Bergleute:
 Berschmannskuh:
volkstümliche
Bezeichnung für die Hausziegen, die viele
Bergmannsfamilien in ihren Wohnhäusern oder im Garten
hielten, weil sie für eine
Haltung größerer Tiere meist nicht genügend Platz zur
Verfügung hatten. Berschmannskuh:
volkstümliche
Bezeichnung für die Hausziegen, die viele
Bergmannsfamilien in ihren Wohnhäusern oder im Garten
hielten, weil sie für eine
Haltung größerer Tiere meist nicht genügend Platz zur
Verfügung hatten.
(Siehe
Bild: "Bergmannskuh - Deutsche Edelziege mit
Zicklein", Bronzeguss-Skulptur von Franz Mörscher;
seit 1995 in der Grünanlage gegenüber dem
Dudweiler Rathaus zu sehen. (Foto: R.Freyer)
Hartfüßler (oder Hartfüßer) nannte man die
Bergleute an der Saar, weil viele von ihnen seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von ihren
Heimatorten aus weite Strecken (bis zu 30 Kilometer)
zu ihren Gruben und zurück zu Fuß laufen mussten.
Schon von Weitem konnte man den Klang ihrer genagelten
Schuhe
auf dem Pflaster der Straßen hören. Man
nannte sie auch Saargänger oder Ranzenmänner.
Kaffekisch:
Das war eine
Kantine mit einem (sehr!) kleinen "Supermarkt" für
Bergleute und ihre Familien.
Knappe: So nennt man die Bergleute, weil
sie als die "Knappen der Königin Kohle" angesehen
werden (ursprünglich bezeichnete das Wort 'Knappe'
einen jungen Adligen, der im Dienste eines Ritters
stand.)
Knubbe: eigentlich Knoten; im Bergbau:
a) bezahlte Überstunde, b) Schnaps, c) "Er hat e
Knubbe": er hat einen im Tee / ist besoffen.
Kolonisten:
So nannte man die im Bergbau Beschäftigten
und ihre Familienangehörigen, die aus entfernten Orten
zugezogen waren und nun in einem ihnen zugewiesenen
Wohngebiet lebten, also in einer "Kolonie" von
Werkswohnungen.
Portion: Wenn man die in einer Kneipe
bestellte, erhielt man 1/4 Ring Lyoner, einen halben
Doppelweck und eine Flasche Bier.
St.
Barbara-Verein (nach
der Schutzpatronin der Bergleute) war der Name der
Bergmanns- oder Knappenvereine im Saarland und in
anderen Zechengebieten.
Saarknappenchor:
Er
wurde 1948 als Männerchor gegründet und gehörte bis
1998 zur Saarbergwerke AG, ab 1998 zur RAG Deutsche
Steinkohle AG. Er gibt noch heute sehr beliebte
öffentliche Konzerte. Ein Bild des Chores aus den
50er-Jahren sehen Sie hier auf dieser Seite, unten im Abschnitt 3a.
|
|
|
1) Geschichte
des Bergbaus an der Saar (bis etwa 1960)
von Stefan Haas und Rainer
Freyer
a) Von den
Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg
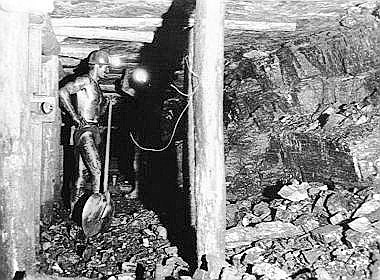 Der Beginn der Kohlenförderung im Saarland
liegt lange zurück: Eine Urkunde aus dem Jahre 1429
erwähnt schon Schürfbetriebe bei Neunkirchen. Es soll
aber schon zu Zeiten der Römer im Saarland Bergbau
gegeben haben. Der Emilianusstollen in St. Barbara
(Wallerfangen) ist ein in Mitteleuropa einzigartiges
Beispiel dafür (allerdings wurde dort nach Kupfer
gegraben). Der Beginn der Kohlenförderung im Saarland
liegt lange zurück: Eine Urkunde aus dem Jahre 1429
erwähnt schon Schürfbetriebe bei Neunkirchen. Es soll
aber schon zu Zeiten der Römer im Saarland Bergbau
gegeben haben. Der Emilianusstollen in St. Barbara
(Wallerfangen) ist ein in Mitteleuropa einzigartiges
Beispiel dafür (allerdings wurde dort nach Kupfer
gegraben).
Im Jahre 1751
zog der Fürst von Nassau und Graf zu Saarbrücken kraft
eines in Deutschland bestehenden Hoheitsrechts den
Besitz der bis dahin privaten Gruben an sich, die zwar
zahlreich, aber wenig bedeutend waren, denn ihre
gesamte Jahresproduktion betrug nur etwa 300 Tonnen.
Als 1792 die Gegend um
Saarbrücken für etwa 20 Jahre an Frankreich fiel,
förderten die Gruben ungefähr 50 000 Tonnen Kohle
jährlich. Im Jahre 1808 beabsichtigte Napoleon, die
Saargruben in mehrere Konzessionen aufzuteilen. Um die
Aufteilung besser durchführen zu können, ließ er die
Lagerstätten auf Staatskosten methodisch erforschen.
Die Ingenieure Duhamel, Beaunier und Calmelet
erledigten diese Aufgabe in drei Jahren
und fassten das Ergebnis ihrer Untersuchungen in einem
Atlas zusammen. Obwohl sich Napoleon schließlich doch
gegen eine Aufteilung entschied und ein einziges
staatliches Unternehmen der Gruben bevorzugte, steht
dieser Atlas am Anfang des wirklich industriellen
Betriebs der Saargruben.
Zum Ende des
Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation am Beginn
des 19. Jahrhunderts kam das Saargebiet 1815 in seinem
Hauptteil zu Preußen und zu einem kleinen Teil (im
Osten) an Bayern. Diese beiden Länder vertrauten die
Kohleförderung ihren jeweiligen fiskalischen
Verwaltungen an.
|
Im
Verlauf des 19. Jahrhunderts förderte der
industrielle Aufschwung die Nutzung und Ausbeutung des
saarländischen Kohlevorkommens. Die Produktion
erreichte im Jahre 1880 fünf Millionen Tonnen.
Während der ersten Jahre des 20. Jahrhunderts
stieg sie weiter erheblich an und erreichte
bis zu 13 Millionen Tonnen im Jahre 1913.
Ab etwa 1850
förderte die Grubenverwaltung den Bau von
Eigenheimen für die Bergleute.
Voraussetzung hierfür war die
Bauausführung nach Musterplänen. Für den
Kauf des Bauplatzes gab es eine Beihilfe,
die so genannte Prämie. Für das
eigentliche Baudarlehen waren vier prozent
Zinsen zu zahlen. Auf der Basis dieses
Finanzierungsmodells wurden bis zum Ende
des ersten Weltkrieges etwa 9 000 solcher
"Prämienhäuser" gebaut. Sie prägten noch in den
50er-Jahren das Straßenbild vieler
saarländischer Ortschaften. Auch außerhalb der
Innenstädte gab es ganze Straßenzüge mit
diesen Häusern.
|
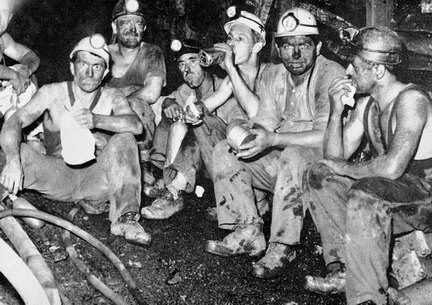
|
|
Das
Foto zeigt saarländische Bergleute bei der
"Halbschicht" im Schacht Holz der Grube Göttelborn,
ca.1956. (Foto:
K. H. Janson)
Im Jahre 1920 wurden die
Saargruben französisches Staatseigentum,
da der Versailler Vertrag sie Frankreich als
Ersatz für die im Ersten Weltkrieg zerstörten
Gruben in Nordfrankreich zugesprochen hatte.
Nach der Volksabstimmung
von 1935 kam die Saar
wieder zu Deutschland, das mittlerweile
unter nationa- lsozialistischer Regierung
stand. Die Saargruben wurden dem französischen
Staat abgekauft und erhielten später die Form
einer Aktiengesellschaft (Saargruben AG),
deren einziger Aktionär das Deutsche Reich
war.
Das
Hitlerreich musste möglichst schnell autark
werden. Um einen Beitrag dazu leisten zu
können, wurde der Bergbau an der Saar zu einem
der modernsten Kohlenabbaubetriebe Europas
ausgebaut. Man setzte die neuesten
Schrämmaschinen und Ladegeräte ein und
verwendete Spülbohrer, um die Gefahr von
Silikoseerkrankungen zu vermindern. Bis zum
Anfang des
Zweiten Weltkrieges
wurde die Kohleförderung auf fast 15 Mio.
Tonnen jährlich gesteigert.
|
|
|
1)
Mission Française des Mines de la Sarre (10.
Juli 1945 bis 31. Dezember 1947)
Nachdem
amerikanische Truppen im März 1945 das Saargebiet
besetzt hatten, stellten sie die im Krieg teilweise
stark zerstörten Bergwerke der Saargruben AG unter die
Kontrolle ihrer CONAD Engineer Mining Operating Group
(Saar Mining Mission). Die Gruben, die noch in Betrieb
waren, förderten inzwischen nur noch unter 5 Mio.
Tonnen pro Jahr.
|
|
Am 10.7.1945
übernahmen die Franzosen die Besetzung des Landes.
Unmittelbar danach gründeten sie die Mission
Française des Mines de la Sarre und
unterstellten ihr die Bergwerke der Saargruben AG.
Leiter der Zwangsverwaltung war zunächst Robert F.
Baboin, später folgte ihm Marin Guillaume.
Die Aufgaben
und Herausforderungen der Mission Française:
- Wiederaufbau
der Belegschaft (Kriegsgefangene,
Rückführung
von evakuierten Bergmannsfamilien,
- Organisation
von Wohnraum,
- Neubeginn
von Aus- und Weiterbildung,
- Sicherstellung
der Versorgung der Belegschaft mit Nahrung und
Bekleidung.
|

|
|
2) Régie des Mines de la
Sarre
(1. Januar 1948 bis 31. Dezember
1953)
|
|

|
Nach der
Gründung des Saarstaats im Dezember 1947 wurden die
Saargruben AG und damit auch die Mission Française zum
1. Januar 1948 aufgelöst. Alle Rechte und
Besitzverhältnisse gingen auf die Régie des Mines de la Sarre mit Sitz
in Saarbrücken über. Deren Verwaltungsrat übernahm nun, als zunächst rein
französische Institution, die Verwaltung der
saarländischen Steinkohlebergwerke einschließlich der
Nebenbetriebe und dazugehöriger Unternehmungen.
Die geförderte
Saarkohle wurde bereits seit dem Kriegsende in einen
gemeinsamen Kohlen-Pool der Alliierten eingebracht.
Diese verteilten die Kohlen nach
gemeinwirtschaftlichen Richtlinien.
Am 20.
Februar 1948 verfügte ein in Berlin
geschlossenes Wirtschafts- abkommen, dass die Saar aus
diesem Pool ausscheiden dürfe. Vom 1. April 1949
an konnte die Régie des Mines die Saarkohle ohne
Auflagen und ohne jegliche Beschränkung absetzen.
Daraufhin begann man sofort mit dem konsequenten
Ausbau der saarländischen Gruben.
|
|
Der Verwaltungsrat
der Régie des Mines bestand aus 30 Mitgliedern, von
denen nur neun die Interessen der saarländischen
Regierung und der saarländischen Unternehmer sowie der
Arbeitnehmerschaft vertraten. Der
Verwaltungsausschuss
war ganz
ohne saarländische Mitglieder.
|
"Die
Saargruben dem Saarvolk"
Der
Industrieverband
Bergbau (IVB, er wurde später
zur Gewerkschaft Bergbau und Energie, IGBE)
forderte
schon von 1948 an, dass die Grubenverwaltung
von der saarländischen Landesregierung
übernommen werden sollte, denn er sei der
Überzeugung, dass
-
die Saargruben als Eigentum
dem Saarland gehören,
-
die Saargruben von
einheimischen Kräften verwaltet werden können,
-
die Saargruben in eigener
Regie Gewinne abwerfen.
Johannes
Hoffmann und seine Regierung waren zusammen
mit den französischen Vertretren im Lande
nicht dieser Meinung, wie der SPIEGEL Ende
1949 berichtete.
(Siehe
nebenstehenden Ausschnitt aus dem SPIEGEL
Nr. 49 vom 1. Dezember 1949!)
|
|
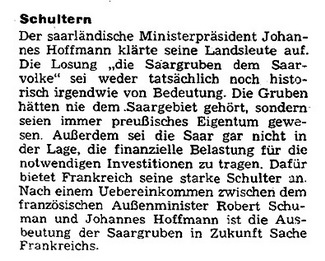
|
|
Die
unzumutbaren Verhältnisse der ungleichen
Zusammensetzung des Verwaltungsrates wurden
durch Neuregulierungen in den Saar-
Konventionen vom 3. März 1950
geändert. Dabei wurden zwei neue Organe mit
jeweils paritätischer Besetzung geschaffen:
a) der
Saargrubenrat, bestehend aus 18
Mitgliedern (neun Saarländer und neun
Franzosen; Vorsitzender war der französische
Minister für Bergbau, Vizepräsident ein hoher
saarländischer Beamter), und
b) der
Grubenausschuss (sechs saarländische
und sechs französische Mitglieder);
Vorsitzender abwechselnd ein Saarländer und
ein Franzose. Außerdem zahlte die Régie an den
saarländischen Staat eine jährliche Abfindung
auf der Grundlage der Nettokohlenförderung.
|
3) SAARBERGWERKE
(S.B.W.)
(1. Januar 1954 bis 31. Dezember 1956)
Am 1.
Januar 1954 löste ein neues Unternehmen mit
Namen SAARBERGWERKE die Régie des Mines ab.
Grundlage dazu war ein Vertrag, der als Teil der
Saarkonventionen am 20. Mai 1953 abgeschlossen wurde.
Frankreich und das Saarland übernahmen damit gemeinsam
die Verantwortung für den Abbau der saarländischen
Kohlenfelder.
Vorstand und Grubenrat waren
weiterhin
paritätisch mit Vertretern beider Länder besetzt. In
dem Vertrag wurde festgelegt, dass er bis zum
Abschluss einer Friedensregelung wirksam bleiben
sollte. Nach erfolgter Anerkennung des Eigentums des
Saarlandes an den Kohlenfeldern und Anlagen sollte
sich die Laufzeit des Vertrages automatisch auf eine
Gesamtdauer von 50 Jahren, gerechnet von 1950 ab,
verlängern. [1]
1956 begannen
die S.B.W. noch mit dem Bau einer neuen Kokerei in
Völklingen-Fürstenhausen. Sie sollte vorwiegend die
lothringischen Hüttenwerke mit Koks versorgen. Ob
wohl deshalb der Beginn der Kokserzeugung auf den
14. Juli 1959 (dem französischen Nationalfeiertag)
gelegt wurde?
[1] Art.
2 des "Vertrages zwischen Frankreich und dem
Saarland über den gemeinsamen Betrieb der
Saargruben" vom 20. Mai 1953.
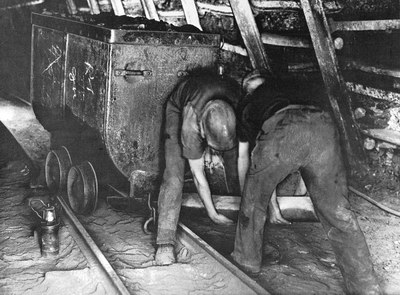 Ende 1956 gliederten sich die
Grubenbetriebe wie folgt: Ende 1956 gliederten sich die
Grubenbetriebe wie folgt:
Bergwerksdirektion
Bexbach.
Gruben: Kohlwald, St. Barbara I, St. Barbara II
Bergwerksdirektion
Neunkirchen.
Gruben: König, Heinitz, Dechen
Bergwerksdirektion
Sulzbach.
Gruben: Maybach, Mellin, Reden-Fett, Reden-Flamm
(Itzenplitz)
Bergwerksdirektion
Fischbach mit
Sitz in Camphausen. Gruben: Camphausen, Franziska,
Göttelborn
Bergwerksdirektion
Jägersfreude. Gruben:
Jägersfreude, Luisenthal, St. Ingbert
Bergwerksdirektion
Geislautern.
Gruben: Velsen, Ensdorf, Griesborn, Viktoria
|
|
1956 erreichte die
Bergwerksdirektion Geislautern eine Höchstförderung von 3,78 Mio. t, gefolgt von der
Bergwerksdirektion Sulzbach (3,48 Mio. t), Fischbach
(3,13 Mio. t), Neunkirchen (2,65 Mio. t), Jägersfreude
(2,52 Mio. t) und der Bergwerksdirektion Bexbach (1,38
Mio. t).
Unter den
einzelnen Schachtanlagen stand die Doppelanlage
Ensdorf-Griesborn an der Spitze (Jahresförderung 1956 1,88 und 1,38 Mio. t), gefolgt von
Göttelborn, während St. Ingbert für 1956 die
niedrigste Förderung mit 253.000 t auswies.
4) Saarbergwerke AG und
die weitere Entwicklung nach der Rückgliederung
Nach
der Ablehnung des Saarstatuts am 23. Oktober 1955 stellte der Saarvertrag vom 27.
Oktober 1956 die Weichen für den Übergang des
Saarbergbaus auf die neuen Eigentümer Bundesrepublik
und Saarland. Der
politische Anschluss der Saar an die Bundesrepublik
erfolgte am 1. Januar 1957. Am
30. September 1957 wurde die Saarbergwerke
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von
35 Milliarden Francs gegründet. Anteilseigner waren
die Bundesrepublik mit 74 und das Saarland mit 26
Prozent.
|
|
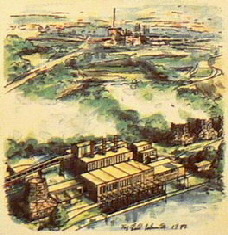
|
1958 erfolgte
die Gründung des Unternehmensverbandes Saarbergbau. Er
vertrat die Belange der Unternehmungen des
Saarbergbaus als Arbeitgeberveinigung und Tarifpartei.
Der Landtag beschloss die Wiedereinführung des
Reichsknappschaftsgesetzes im Saarland und
verabschiedete das Neuregelungsgesetz der
Knappschaftsrentenversicherung.
In dieser Zeit
verfügte die Saarbergwerke AG über 99 aktive Schächte.
Davon dienten 24 als Förderschächte, die übrigen waren
für Seilfahrt, Materialtransport und
Frischluftversorgung zuständig. Schon ab 1956
versuchte man, den sich abzeichnenden Kohle- und
Strukturkrisen durch eine Ausweitung der
Mechanisierung zu begegnen, indem man
z.B. Walzenschrämlader und Hydraulikstempel einführte.
Bald wurden auch Verbundbergwerke und neue Betriebe
geschaffen. Im Jahr 1958 mussten die ersten
Feierschichten eingelegt werden, weil die
Absatzverhältnisse auf dem Energiemarkt sich zunehmend
verschlechterten. Um dieser Entwicklung zu begegnen,
versuchte die Saarbergwerke AG, neue Absatzwege z.B.
in der Veredlung der Kohle zu Koks, Gas und Strom zu
finden.
|
|
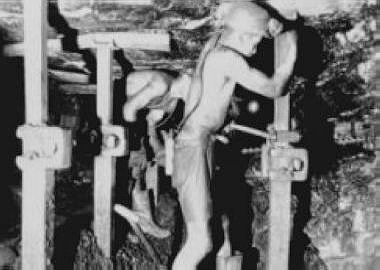 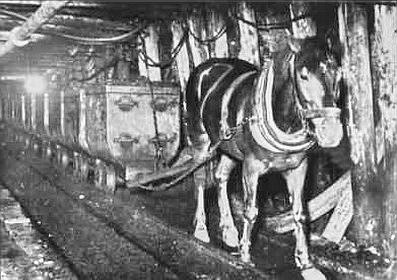
Im
Kammerbau werden Eisenstempel gestellt.
Bis
1960 wurden auch im Saarbergbau Pferde unter Tage
eingesetzt.
Die S/W-Fotos in dem obigen Abschnitt
ohne eigene Quellenangabe wurden mit freundlicher
Genehmigung der hervorragenden Website
von "Kumpel Horst" entnommen: http://www.hschmadel.de/
-
Die Farbzeichnung ist von F.L. Schmidt.
|
|
c)
Tabellen
zu
Förderung und Absatz der Kohle
I)
Kohleförderung im Saarland von 1913 bis 1956
 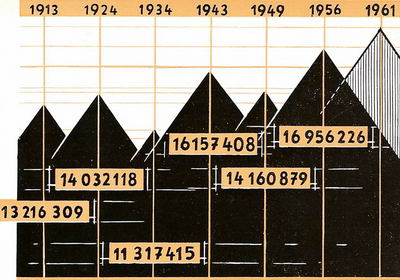
Entwicklung
der Tagesförderung in Tonnen Kohlen
Entwicklung
der Jahresförderung in Tonnen Kohlen
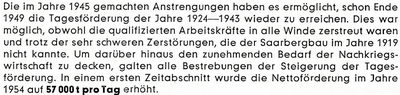 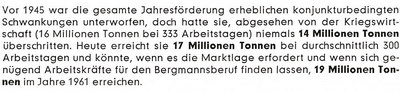
(aus
der Saarbergwerke-Broschüre "Die Saargruben 1945 - 1957, 12
Jahre französisch-saarländische Verwaltung")
|
II)
Absatzpolitik
Die an
der Saar geförderte Kohle wurde zu einem guten
Drittel im Saarland
selbst verbraucht; Abnehmer waren hier neben
der Bevölkerung hauptsächlich die Eisen- und
Stahlindustrie.
Ein
etwas geringerer Anteil an Kohlen wurde nach
Frankreich (hauptsächlich in den Osten des
Landes und in die Zone um Paris) geliefert,
und ein noch kleinerer Teil ging nach
Deutschland. Der Rest verteilte sich auf
zahlreiche andere Länder.
Die
nebenstehende Tabelle zeigt die genauen Mengen
je Land in den Jahren 1948 bis 1956.
Tabelle
aus: Rauber, Franz: 250 Jahre staatlicher
Bergbau an der Saar. Teil 2: Von den Mines
Domaniales Françaises de la Sarre bis zur
Deutschen Steinkohle AG. Sotzweiler
2003, Seite 205
|
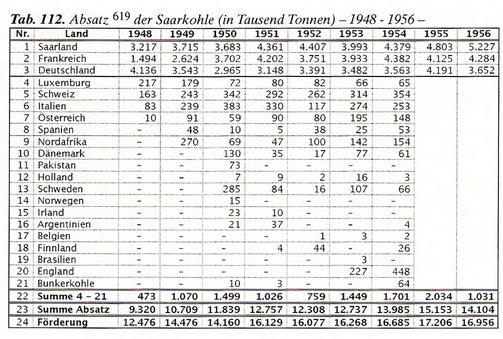
|
|
Die
Steinkohlengruben an der Saar -
Stand: 1957
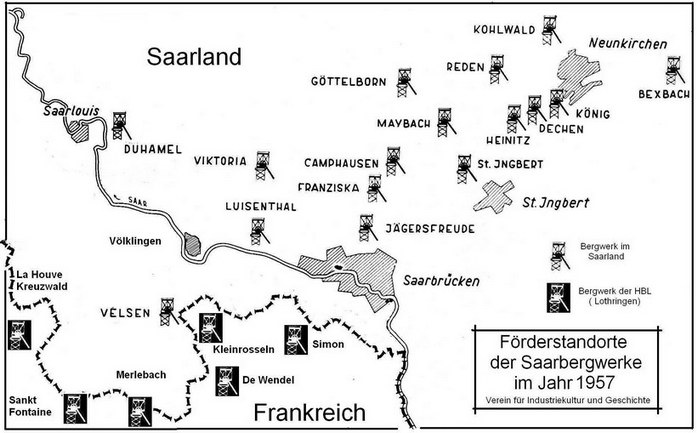
|
2)
Die saarländischen Steinkohlenbergwerke
der
Nachkriegszeit und ihre Namensgeber
von
Stefan Haas und Rainer Freyer
Zeichnungen
von Fritz Ludwig Schmidt (mehr über den Zeichner ganz unten auf
dieser Seite!)
Zu einer
ausführlicheren Einzelbeschreibung von einzelnen
Gruben folgen Sie bitte den blauen Links in den
Überschriften! (dies betrifft die Gruben
Camphausen, Jägersfreude und Viktoria
Die Namen von
Gruben, Schächten, Flözen und Fördertürmen sind ein
signifikantes Merkmal des
Bergbaus - nicht nur im Saarland. Sie spiegeln ein
großes Stück der im Untergang begriffenen
Industriekultur wieder. Ihre Namen sind somit ein
Spiegelbild von Tradition und Kultur. Bei der Gründung der Saarbergwerke AG im
Herbst 1957 waren 18 fördernde Gruben in Betrieb. Das Unternehmen
verfügte damals über insgesamt hundert Schächte,
die als Förderschächte, Wetter-, Material-, und
Seilfahrtschächte dienten. Sie prägten in den
fünfziger Jahren das Bild ihrer Umgebung und nahmen
den Namen des jeweiligen Ortes an, oder der Ort
erhielt den Namen der dort befindlichen Grube. Wie
lauten diese Namen, was steckt hinter ihnen und was
sagen sie aus? Im Folgenden soll ein
ausschnittartiger, kein vollständiger, Überblick über
die Namen dieser Gruben gegeben werden, von denen
viele schon sehr bald, nämlich in den sechziger
Jahren, geschlossen werden sollten. Die Reihenfolge
der Nennung
entspricht der Rangfolge ihrer Produktivität; die
ersten sechs förderten am längsten, die restlichen
wurden frühzeitig geschlossen.
|

Emblem in
der Fassade der ehemaligen
Saarbrücker Bergwerksdirektion
(Foto:Stefan Haas)
|
|
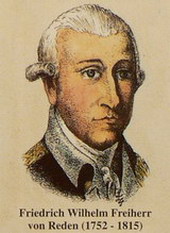
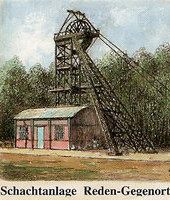
|
Grube
Reden
Die
Grube in Landsweiler-Reden
entstand
um 1850 und wurde benannt nach dem preußischen
Staatsminister Friedrich-Wilhelm
Graf von Reden (1752-1815). Jener war schlesischer
Berghauptmann, preußischer Oberberghauptmann
und Minister. Er führte den darniederliegenden
Bergbau in Schlesien zu einer neuen Blüte.
a)
Reden-Flamm war
lange Zeit der Name für den Schacht Itzenplitz in Heiligenwald. Itzenplitz lebte von
1799-1883 und war
preußischer Minister und Naturwissenschaftler.
Unter seinem Namen war der Schacht bis zur
Integration in die Grube Reden (am 31. März
1958) ein eigenständiger Betrieb.
b)
Reden-Fett war
die zweite große Betriebseinheit in Reden.
Beide Teile zusammen galten als eine
|
|
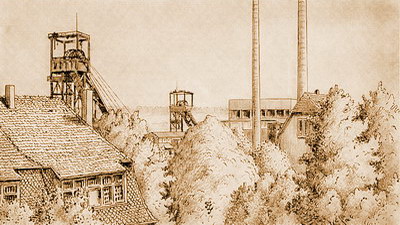
 bedeutende Grube im Saarbergbau, die in der Mitte des 19.
Jahrhunderts entstanden war und noch 1980 mit
ca. 3100 Mann 6800 t Kohle pro Tag förderte.
1989 erfolgte ihr Verbund mit
der Grube Göttelborn. bedeutende Grube im Saarbergbau, die in der Mitte des 19.
Jahrhunderts entstanden war und noch 1980 mit
ca. 3100 Mann 6800 t Kohle pro Tag förderte.
1989 erfolgte ihr Verbund mit
der Grube Göttelborn.
Die
Schachtanlage Reden-Gegenort war um 1900 über dem
Schacht III der Grube Frankenholz am Standort
Höchen erbaut worden. Im Jahr
1960 wurde sie an den heutigen Standort bei
Bauershaus (zwischen Neunkirchen und
Ottweiler) versetzt.
|
|
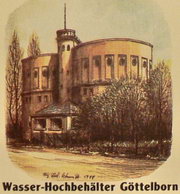
|
Grube Göttelborn
Benannt
nach der Gemeinde Göttelborn, deren Name auf die Quelle
"Gödelborn" zurückgeht. 1884 fanden erste
Kohleschürfungen im Bereich des heutigen
Ortes statt und es erfolgte der Anhieb der
Grube Göttelborn. Betriebsbeginn war 1887.
1980
förderte die Grube Göttelborn bei einer
Belegschaft von ca. 2200 Mann 7500 t Kohle
pro Tag. Bei einem zu diesem Zeitpunkt
geschätzten Kohlevorrat von 200 Mio. Tonnen
ging man auch hier von einer noch langen
Förderdauer aus. Das Verbundbergwerk Göttelborn-Reden entstand 1989. Schon
acht Jahre später, nämlich 1997, wurde im
Jahr des 110-jährigen Bestehens der Grube
die Schließung des Verbundbergwerkes
Göttelborn-Reden trotz großer Proteste
seitens der Bevölkerung beschlossen.
|
|
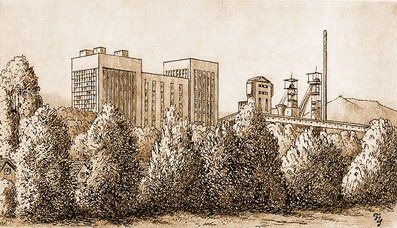
|

|
Grube
Camphausen
Die
1871 abgeteuften Fischbachschäch- te wurden 1874 nach dem
Besuch des preußischen Finanzministers in
Trier, Regierungsrat Otto Camphausen (1812
- 1896) in Grube Camphausen umbenannt. Die
Namensgebung der Grube wurde ihm zur Ehre, da
er dem aufstrebenden Bergbau an der Saar
wirksame (finanzielle) Hilfe zukommen ließ.
Die Grube galt 1980 als prosperierender
Betrieb, der bei einer Belegschaft von ca.
1400 Mitarbeitern etwa 3500 t Kohle pro Tag
förderte.
|
|
Mehr
Infos und Fotos zur Grube Camphausen finden
Sie auf unserer Seite Gruben
in Dudweiler.
|
|
Grube Luisenthal
Benannt nach einem
Hof, der den Namen einer Tochter des Grafen
Friedrich Ulrich von Ostfriesland
(1667-1710), Christiane
Luise,
trug. Jener war ein Schwiegersohn der
Verbindung Fürst Christian Eberhard von
Ostfriesland und Eberhardine Sophie zu
Oettingen-Sötern (1666-1700). Die Benennung geht
auf das Jahr 1951 zurück und löste die
1836 eingeführte Bezeichnung "Obervölklingen" wieder ab. Der
heutige Stadtteil von Völklingen
profitierte damals sehr vom
wirtschaftlichen Aufschwung, wuchs rasch
an und wurde nicht zuletzt durch die
Rückbenennung unabhängiger vom großen
Völklingen. - Angehauen wurde diese Grube 1899.
Nach sehr wechselvollen Jahren und von dem
schweren Grubenunglück im Jahre 1962
überschattet (siehe unten, im Abschnitt
4), förderte sie im Jahre 1980 bei
einer Belegschaft von ca. 2200 Bergleuten
5000 t Kohle pro Tag.
|
|

|
|
Grube Ensdorf (Grube Griesborn, Grube Duhamel)
1945 wurde die Grube Griesborn mit dem
Steinkohlenbergwerk Ensdorf-Viktoria zusammengelegt, die
Förderanlage in Griesborn wurde 1950
geschlossen, ihre Fördereinrichtung
abgerissen und die gesamte Förderung
unterirdisch auf einem neu geschaffenen acht
Kilometer langen Stollen zur Grube
Duhamel gebracht, wo sie zu Tage
gehoben wurde. Der Name der
Letzteren geht auf Jean Baptiste Duhamel
(1767-1847) zurück, Professor für
Bergbau und Direktor der Bergschule in
Geislautern. Er schuf 1810 zusammen mit
anderen Bergingenieuren Napoleons den ersten
Saargrubenatlas. Die Grube Griesborn war nach dem
gleichnamigen Ort bei Schwalbach
benannt.1957 legte man beide Gruben zusammen
und gab ihnen den Namen des Ortes Ensdorf.
Der Name Saarschacht (1913-1920 und 1935-1945) setzte
sich nicht durch. wurde. Der Name der
Letzteren geht auf Jean Baptiste Duhamel
(1767-1847) zurück, Professor für
Bergbau und Direktor der Bergschule in
Geislautern. Er schuf 1810 zusammen mit
anderen Bergingenieuren Napoleons den ersten
Saargrubenatlas. Die Grube Griesborn war nach dem
gleichnamigen Ort bei Schwalbach
benannt.1957 legte man beide Gruben zusammen
und gab ihnen den Namen des Ortes Ensdorf.
Der Name Saarschacht (1913-1920 und 1935-1945) setzte
sich nicht durch.
Ensdorf gehörte 1980
mit einer Fördermenge von 11000 t Kohle pro
Tag und einer Leistung von 8000 kg je
Mannschicht zur europäischen Spitzengruppe.
2600 Bergleute waren zu dieser Zeit hier
beschäftigt, die noch geschätzte 300 Mio. t
Kohle zum Abbau vor sich hatten.
|
|
Grube
St. Barbara (Bexbach)
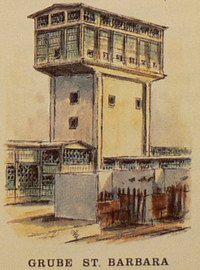 Zu Ehren der Hl. Barbara,
der Schutzpatronin der Bergleute 1955 von
SAARBERGWERKE bei Bexbach in Verbund mit einem Kraftwerk
eingeweiht. Die Tagesförderung lag bei einer
Belegschaft von rund 2400 Beschäftigten bei
ca. 1500 Tonnen. Zu Ehren der Hl. Barbara,
der Schutzpatronin der Bergleute 1955 von
SAARBERGWERKE bei Bexbach in Verbund mit einem Kraftwerk
eingeweiht. Die Tagesförderung lag bei einer
Belegschaft von rund 2400 Beschäftigten bei
ca. 1500 Tonnen.
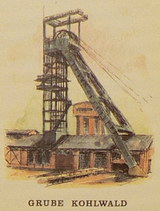 1959 wurde sie wegen mangelnder
Rentabilität von der Saarbergwerke AG
geschlossen.
1959 wurde sie wegen mangelnder
Rentabilität von der Saarbergwerke AG
geschlossen.
Grube Kohlwald
Benannt wurde diese
Grube bei Wiebelskirchen vermutlich nach dem
Flurnamen "Kollwald", es besteht aber auch
die Möglichkeit eines Bezuges zu den ersten
Kohlegräbereien im 15. Jahrhundert oder zur
Kohlegewinnung durch aufgestellte Meiler in
diesem Wald. Die Stilllegung der Grube 1966
brachte
zwar die dortige Förderung von 3650 t Kohle
pro Tag durch eine Belegschaft von 2200 Mann
zum Erliegen, die Kohlefelder wurden aber an
die Grube Reden angeschlossen. Hier spielten
auch die Annaschächte als zeitweiliger
Förderstandort eine große Rolle. Sie waren
benannt nach der Ehefrau des
Oberberghauptmanns von Velsen.
|
|
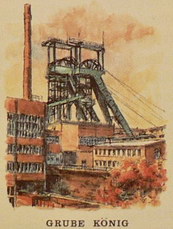
Grube König
("Königsgrube")
Benannt wurde die Grube bei Neunkirchen zu Ehren des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840), der 1821
Saarbrücken besuchte. Bergmännisch geht sie
auf den 1821 angehauenen
Friedrich-Wilhelm-Stollen zurück, der Teil
der Königsgrube war.
Vor der Stilllegung im
März 1968 wurden auf dieser Anlage täglich
5200 t Kohle gefördert, bei einer
Belegschaft von 3600 Bergleuten. Die
unterirdische Kohlelagerstätte wurde nach
der Schließung der Grube Reden zugetragen.
|

|
|
Grube
Dechen
Diese
Anlage liegt bei Neunkirchen und wurde nach dem
Oberberghauptmann Dr.
Heinrich von Dechen (1800-1889) benannt. Er war zu
seiner Amtszeit für die Bergaufsicht im
Saarland verantwortlich. Vor seiner Amtszeit
als Oberberghauptmann in Bonn war er als
Professor für Bergbaukunde in Berlin tätig und
trug dazu bei, Geologie als eigenständige
Disziplin zu etablieren.
Hier
wurde von 1854 bis 1964 wertvolle Kokskohle
gefördert. In den Jahren vor der Stilllegung
förderten 1700 Bergarbeiter 2200 Tagestonnen.
Die Lagerstätte wurde dem Feldesteil Reden
zugewiesen
|

|
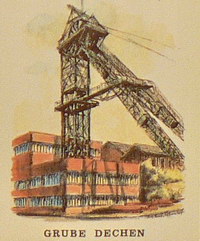
|
|
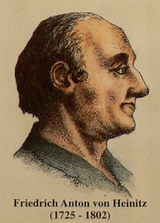
|
Grube Heinitz
Benannt wurde diese im Stadtbereich Neunkirchens liegende Grube im
Jahre 1851 nach dem bedeutenden preußischen
Staatsminister für Bergwerks- und
Hüttenwesen Friedrich
Anton Freiherr von Heinitz(1725-1802). (Sein
Nachfolger in diesem Amt war Freiherr von
Reden.)
Zu bemerken gilt die
Tatsache, dass Heinitz als Lehrer großen
Einfluss auf den späteren preußischen
Staatsmann Freiherr von Stein nahm. In den
letzten Jahren ihres Betriebes erzielte sie
eine tägliche Förderung von knapp 3000 t bei
einer Belegschaft von ca. 2900 Mann. Im
November 1962 wurde diese Grube stillgelegt,
und die Kohlevorräte wurden ebenfalls
der Förderanlage Reden zugeordnet.
|
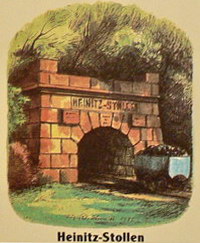
|
|
 Grube Maybach Grube Maybach
Um das
Jahr 1883 wurde die Grube "Tränkelbach" von 1871 bei Friedrichsthal nach dem preußischen Minister Albert von Maybach (1822-1904) umbenannt.
Unter Bismarck wurde dieser 1874 Leiter des
Reichseisenbahnamtes, ferner war er
langjähriges Mitglied des Reichstages und ab
1878 Minister der öffentlichen Arbeiten.
Auch diese Grube förderte über Jahre hinweg
wertvolle Kokskohle bis zu ihrer Schließung im
Jahr 1964. Auch dieser Feldesteil wurde der
Grube Reden zugeschlagen. Sie förderte damals
5000 t täglich bei einer Belegschaft von 4300
Bergleuten.
|
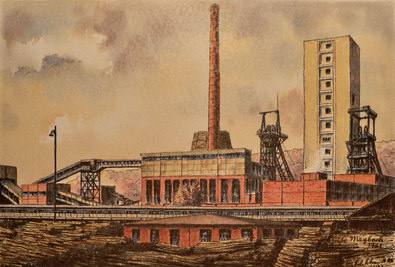
|
|
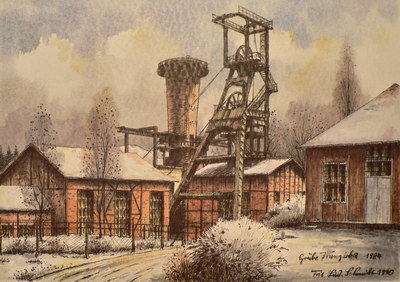
|
Grube
Franziska
Franziska war eine Tochter aus preußischem
Königshaus, der zu Ehren diese Grube bei
Quierschied benannt wurde. Damit war sie -
neben der Grube Viktoria - die einzige Grube,
die den Namen einer Frau erhielt, sonst
geschah dies nur mit Schächten. Die Grube war
ursprünglich eine Abteilung der Grube
Camphausen gewesen, deren Westschacht 1920 in
Franziska-Schacht umbenannt wurde. In den
vierziger Jahren wurde Franziska II abgeteuft.
Sie war von
1950 bis 1960 eine selbstständige Grube mit
eigener Betriebsdirektion, wenn auch die
Förderung weiterhin über die Grube Camphausen
gehoben wurde.
Franziska
hat damals bei einer Belegschaft von 2300
Beschäftigten eine Förderung von 3200
Tagestonnen erreicht. 1960 wurde sie an
Camphausen angeschlossen.
|
|
Grube
Mellin
Die
Schächte bei Sulzbach wurden 1852 abgeteuft
und zunächst wegen ihrer Lage
Eisenbahnschächte III und IV genannt. Im Jahre
1858 wurden sie zu Ehren des preußischen Ministerialdirektors
Mellin
in Grube Mellin umbenannte.
Mellin
lebte von 1796-1859 und war als Regierungsrat
im Finanzministerium, Ministerialdirektor im
Ministerium für Bau und Gewerbe sowie seiner
Verdienste im Eisenbahnwesen als
Generalbaudirektor tätig. Mellin fand 1952
Anschluss an Maybach. Sie förderte in den
letzten Jahren mit 2200 Mann 2200 t Kohle pro
Tag.
|

|
|
Grube
St. Ingbert
Auch
wenn sich die Tätigkeit des Heiligen Ingobertus als Einsiedler auf dem
Gebiet von St. Ingbert historischen Beweisen
entzieht, löst der Name St. Ingbert doch die
ursprüngliche Bezeichnung Landolvinga bzw.
Lendelfingen mit dem Beginn des
Dreißigjährigen Krieges ab.
Erstaunlicherweise
lag die Verwaltung der Grube nicht nur beim
Grafen von der Leyen und bei französischen
Stellen, sondern auch bei einer russischen und
einer österreichischen Grubenverwaltung
(1814-1816). Geschlossen wurde die St.
Ingberter Grube im Jahr 1959.
Die
Förderung dieser eher kleinen Grube lag
zuletzt bei 500 t Kohle pro Tag durch 450
Mann.
|
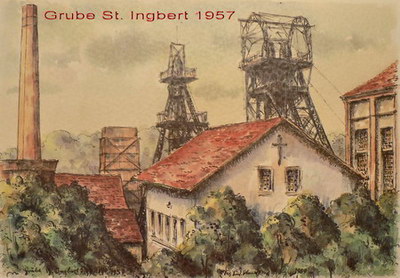
|
|
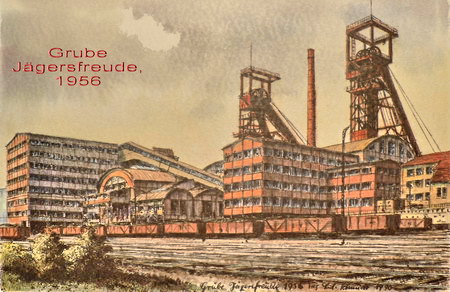
|
Grube
Jägersfreude
Benannt
nach dem Ort Jägersfreude, welcher seinerseits
nach einem Jagdschloss des Fürsten von Nassau-
Saarbrücken benannt wurde. Auch diese Grube
traf im Jahr 1968 die Stilllegung, wenngleich
der untertägige Anschluss an Camphausen die
weitere Nutzung der Lagerstätte möglich
machte.
Die
Anlage hatte zuletzt eine Förderung von 4700 t
Kohle pro Tag erbracht, die Belegschaft von
2900 Bergleuten stammte mehrheitlich aus dem
Bliesgau.
Mehr
Infos und viele zeitgenössische Fotos zur
Grube Jägersfreude finden Sie auf der Seite
Gruben
in Dudweiler.
|
|
 Grube Viktoria Grube Viktoria
Diese
Grube lag am Ortsrand von Püttlingen, wurde ab 1869 abgeteuft und nach
der damaligen Kronprinzessin Victoria Adelaide Mary Louisa von Sachsen-Coburg und
Gotha, geborene Princess Royal von
Großbritannien und Irland (1840 bis 1901)
benannt. Sie war das erste Kind von Albert von
Sachsen-Coburg und Gotha und Königin Victoria
von Großbritannien. Nach ihrer Heirat mit
Friedrich III. war sie preußische Königin und
deutsche Kaiserin und später Mutter von Kaiser
Wilhelm II. -
Weitere Infos und
Fotos gibt es auf der Seite Grube Viktoria.
|
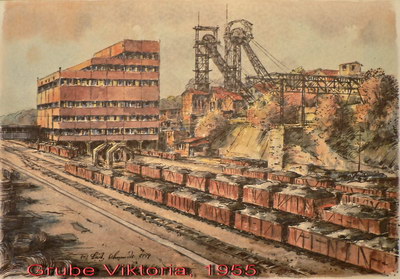
|
|
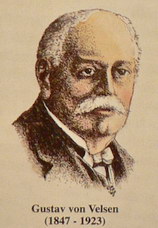
|
Grube
Velsen
Benannt
nach dem Oberberghauptmann Gustav von Velsen im Jahre 1907, nach
dessen Besuch bei der Anlage in Großrosseln im Rosseltal. Jener war
von 1881 bis 1886 Vorsitzender der
Bergwerksdirektion in Saarbrücken. Die Grube
Velsen wurde im August 1965 Nebenanlage des
Bergwerks Warndt, sie förderte Anfang der 60er
Jahre 4500 t Kohle pro Tag mit einer
Belegschaft von 3100 Bergleuten
|
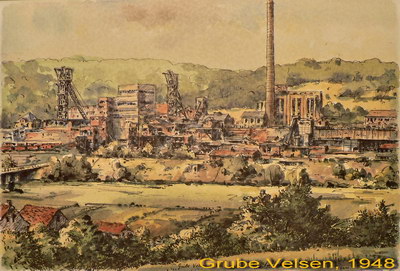
|
|
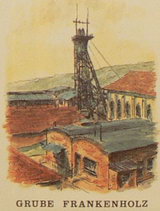
|
Grube
Frankenholz
Am 2.
Januar 1941 kam es hier zu einer schweren
Schlagwetterexplosion, bei der 41 Bergleute
ihr Leben verloren. Nach diesem Unglück wurden
die Arbeiten in der Grube für Jahre
eingestellt, bis die Brände eingedämmt waren.
1947
wurde Jules Baumann Direktor der Frankenholzer
Grube. Als unter seiner Leitung 1954 das
Bergwerk St. Barbara in Bexbach entstanden
war, wurden die Kohlen des Frankenholzer
Grubenfeldes direkt in Bexbach zu Tage
gefördert.
Am 30.
April 1959 stellte die Saarbergwerke AG die Kohlenförderung in
Bexbach ein.
|
|
Anhang
Einige
bekannte saarländische Gruben sind in der
obigen Aufstellung nicht erwähnt, weil sie zur
Zeit des autonomen Saarlands entweder bereits
geschlossen oder noch nicht eröffnet waren.
Diese
sollen
hier genannt werden:
Die Grube Sulzbach-Altenwald bestand
von etwa 1747 bis 1932; dann wurde sie von
den Franzosen geschlossen.
|
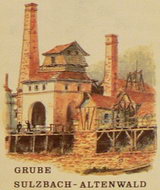
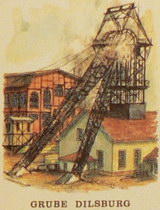
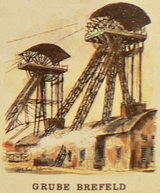
|
|
 Grube Von der Heydt:
Diese Grube wurde 1850 vom Preußischen
Bergfiskus gegründet und nach dem
preußischen Handels- und Finanzminister August
Freiherr von der Heydt
(1801-1874) benannt. Ihre Entwicklung
endete aber als Folge der
Weltwirtschaftskrise schon 1932. Grube Von der Heydt:
Diese Grube wurde 1850 vom Preußischen
Bergfiskus gegründet und nach dem
preußischen Handels- und Finanzminister August
Freiherr von der Heydt
(1801-1874) benannt. Ihre Entwicklung
endete aber als Folge der
Weltwirtschaftskrise schon 1932.
In den Jahren 1951/52 wurden die
beiden Amelung-Schächte
nochmals gesümpft und als ausgehende
Wetterschächte der Püttlinger Grube Viktoria genutzt; 1965 wurde
die Grube von der Heydt endgültig
stillgelegt.
Die Grube Geislautern war
etwa 1730 entstanden und wurde schon 1908
stillgelegt.
Grube
Dilsburg: Die
Anlagen dieser Heusweiler Grube wurden etwa
zwischen 1910 und 1916 erstellt. Maximal
förderte die Grube 234.000 Tonnen Steinkohle
im Jahr. Die Belegschaft bestand aus bis zu
1400 Arbeitern und Beamten. Im Zuge der
Weltwirtschaftskrise wurde die Grube am 26
6.1931 "vorübergehend" stillgelegt.
Es kam aber nie wieder
zu einer Wiederinbetriebnahme in der alten
Form. Allerdings wurde der Schacht Dilsburg
von 1966 bis 2000 wieder für das Bergwerk
Ensdorf und später für die Grube Göttelborn in
Betrieb genommen.
Die Grube Brefeld wurde
1872 eröffnet und 1935 mit Camphausen durch die
Saargrubenverwaltung zu einem Verbundbergwerk
zusammengelegt. Ab 1942 wurden die Flöze der
Grube Brefeld nicht mehr weiter abgebaut. Dies geschah erst
wieder, als die Privatgrube
Brefeld 1956
die Abbaugenehmigung für die Flöze erhielt.
1962 war auch für sie der letzte Fördertag.
Die
Grube
Warndt entstand
erst in den späten 50er- bzw. frühen
60er-Jahren.
|
--------------------------------------------------------
Auf unserer Seite Grube Viktoria finden Sie eine
Einzelbeschreibung dieser Grube in Püttlingen mit Fotos aus den 50er Jahren.
Die
Seite Gruben in Dudweiler beschreibt in Texten und Bildern die Anlagen
in Hirschbach, Jägersfreude und Camphausen.
Weiterführende
Literatur zu den Grubennamen:
- Schuster,
Gerd: Grubennamen an der Saar.
Wirtschaftshistorische Betrachtungen. Sonderdruck aus
dem Saarbrücker Bergmanns-
kalender
1980.
- Ruth, Karl-Heinz: Fürsten und
Bergleute gaben saarländischen Gruben ihren Namen. In: Saarbrücker
Bergmannskalender 1998, S.
135 - 147.
|
|
3)
Verschiedenes aus dem
Saar-Bergbau
|
a) Der
Saarknappenchor...
...
wurde im Jahr 1948 gegründet. Unter der
Leitung seines ersten Dirigenten Peter Marx
errang er viele Jahre lang große Erfolge bei
unzähligen Auftritten im Saarland.
Der
Chor reiste auch zu zahlreichen Auftritten im
In- und Ausland.
So
wurde er schon früh zu einem musikalischen
Botschafter
unseres Landes. 2018 wurde das Jubiläum „70
Jahre Saarknappenchor“ gefeiert.
Zum Bild rechts: Auf dem Titelbild
dieser Ausgabe der monatlich erscheinenden Werkszeitung der Saarbergwerke AG
"Schacht
und Heim" sehen wir den Saarknappenchor bei einem Besuch in
Mosbach/Baden vor dem "Palmschen Haus" am
dortigen Marktplatz in den 50er-Jahren.
|

|
b) Das Steigerlied:
"Glückauf! Der Steiger kommt." mit Zeichnungen aus
dem Saarbergbau
Nähere
Erläuterungen zu diesem Lied finden Sie auf unserer
Seite Name,
Flagge, Wappen, Siegel, Hymnen im
Abschnitt E) Hymnen.
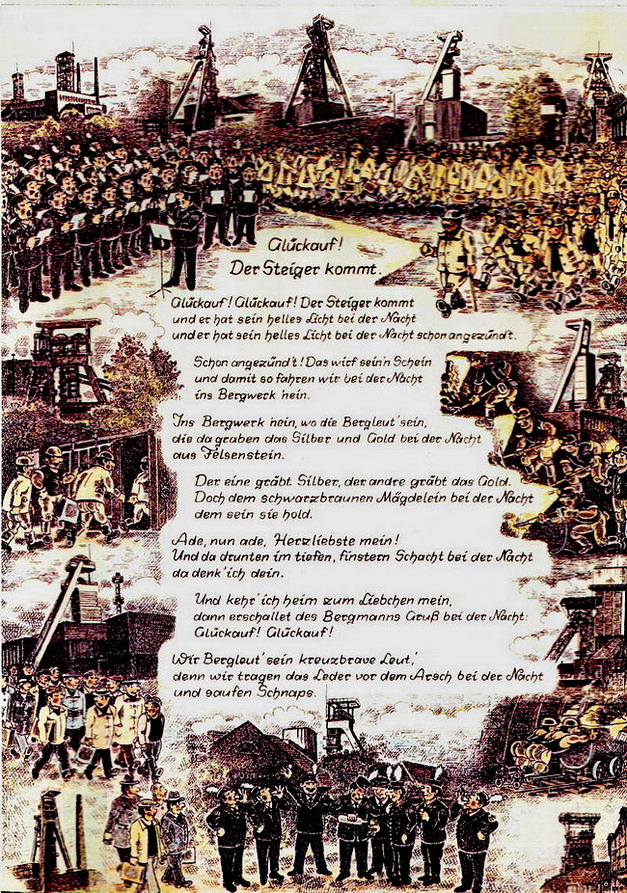
Der Zeichner dieses Blattes
ist leider unbekannt.
c) 1947: 100
Jahre Grube Heinitz

Die Grube
HEINITZ feierte 1947 im Beisein von Gouverneur
Gilbert Grandval ihr 100-jähriges Bestehen. Diese
Gedenktafel
wurde
damals am Mundloch des Heinitzstollens angebracht
und ist noch heute (Stand 2008) dort zu sehen.
Auf der Tafel
sind als weitere Teilnehmer bei der Zeremonie am 12.
Juli 1947 vermerkt: Generaldirektor R. Baboin,
M. Motreul,
Chef der Gruppe Ost, J. Quoniam, Grubendirektor, und
W. Wrede, Betriebsdirektor.
(Foto:
Stefan Haas)
d) Mit bebilderten Broschüren bewarb
die Grubenverwaltung in den 50ern den Bergmannsberuf:

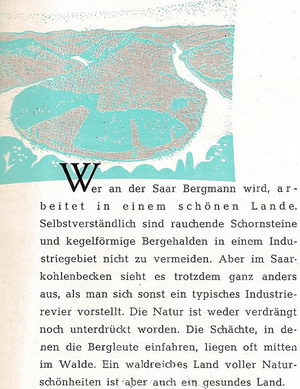
|
|
^
Wie das markante Namenszeichen verrät,
wurden diese
Zeichnungen von Fritz Ludwig Schmidt erstellt.
|
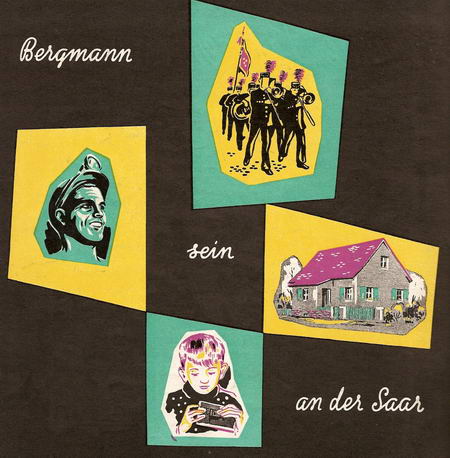
|
|
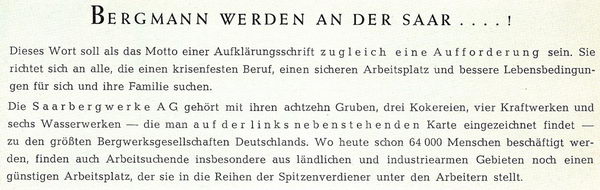
|
|
aaa
4) Gruben-Unglücke im Saarland
(zusammengestellt
von Rainer Freyer)
A) In der Zeit von
1945 bis 1958
In diesem
Zeitabschnitt ereigneten sich 7 Grubenunglücke mit tödlichem Ausgang.
Hinweis:
Unglücke vor und nach der Saarstaatzeit
werden im Abschnitt B erwähnt.
1) am
23.12.1948 Grube Duhamel (zum Bergwerk
Ensdorf gehörig):
20 Tote
Ein großer
offener Grubenbrand erforderte schwierige
Rettungsarbeiten durch die Grubenwehr. Die betroffenen
Bergleute waren von plötzlich auftretenden
Rauchschwaden überrascht worden. Von wem oder wodurch
der Brand ausgelöst worden war, konnte nicht geklärt
werden. Es waren 20 Tote
zu beklagen
(siehe Foto-Bericht aus
der ILLUS weiter unten).
2) am
17.5.1950 Grube Mellin (bei Sulzbach):
2
Tote
Während der
Seilfahrt um 14 Uhr brach ein größerer Gesteinsbrocken
aus der Schachtwandung des Schachtes 1 aus, schlug auf
den aufwärts stehenden Korb auf und durchschlug das
Korbdach. Zwei
Bergleute wurden tödlich getroffen und zwei weitere
mittelstark verletzt. (Quelle: Landesarchiv Saarbrücken,
Bestand Inf.A Nr. 210)
3) am
25.4.1952 Grube König (Neunkirchen):
7 Tote
Nach einer
Schlagwetterexplosion konnten 7 Bergleute nur noch tot geborgen werden.
4) am
17.5.1954 Grube Franziska (Quierschied):
9
Tote
Eine Gruppe von
Bergleuten wurde von hereinbrechenden Gesteinsmassen
verschüttet. Dieses Unglück verursachte den Tod von 9
Bergleuten.
5) am
7.6.1955 Grube Heinitz: 11 Tote
(siehe
Zeitungsbericht unten)
6) am
23.8.1956 Grube Kohlwald: 1 Toter (aus Schiffweiler) (Westf. Rundschau 25.8.56)
7) am
8.10.1958 Privatgrube der Dr. Arnold
Schäfer GmbH in Güchenbach: 3 Tote
Infolge eines
Strebbruchs hereinbrechende Gesteinsmassen kosteten drei Berg- männern das
Leben; einer wurde schwer verletzt, drei waren
verschüttet.
Die Daten
zu Nr. 1 bis 4 stammen aus dem Buch von Evelyn
Kroker (siehe weiter unten unter "Literatur"!)
|
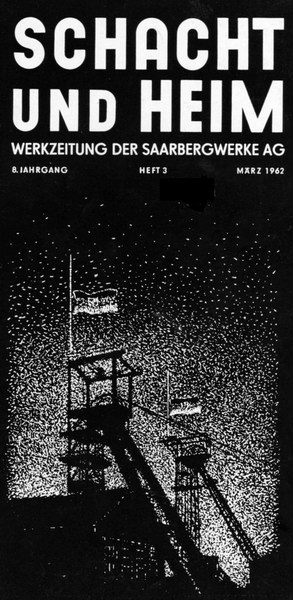
Titelbild
der Werkszeitschrift der Saarbergwerke
nach dem
Grubenunglück in Luisenthal 1962
(siehe
dazu weiter unten!)
|
|
→
Rechts:
(zu
Nr. 1 der
obigen
Aufstellung)
Grubenunglück
am
23. Dezember
1948 auf der Grube Duhamel
Bildbericht
aus der saarländischen Illustrierten ILLUS vom 21.
Januar 1949
|

|
Zeitungsausschnitt unten:
(gehört zur
Nr. 5 der
obigen
Aufstellung
von
Grubenunglücken)
Grubenunglück
am 7. Juni 1955 auf der Grube Heinitz
Bericht
aus NEUE ZEIT, dem Organ der Kommunistischen Partei
Saar, vom 9. Juni 1955
Die Partei
kritisierte darin wieder - wie schon öfter an
anderer Stelle - die Abbaumethoden im Saarbergbau
und sprach von "unmenschlichem Raubbau".
↓
|
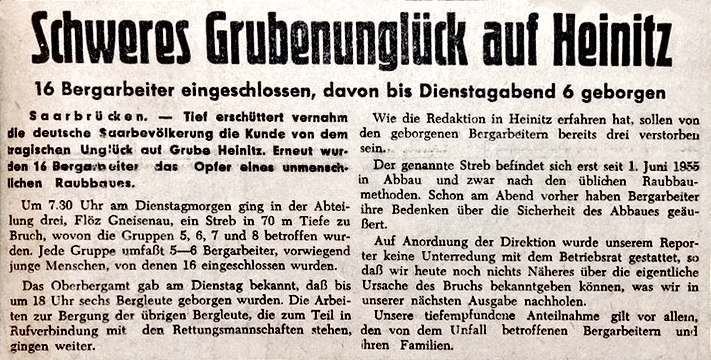
|
B)
Schwere Grubenunglücke im Saarland vor und
nach der Saarstaatzeit
|
1885
-
17./18.
März: Grube
Camphausen,
180 Tote
1907
- 28. Januar: Grube Reden, 150 Tote
16. März:
Mathildenschacht
bei Püttlingen, 22
Tote
1930
- 25. Oktober: Grube Maybach: 100 Tote
|
1941
- 2. Januar: Grube Frankenholz, Schlagwetterexplosion,
41 Tote
16.
Juli: Grube Luisenthal,
31 Tote
(für
die Jahre 1948 bis 1958: siehe oben
im Abschnitt A)
1962 - 7.
Februar: Grube
Luisenthal, 299 Tote: siehe hier
unten!
1986 - 16.
Februar: Grube Camphausen, 7 Tote
|
|
|

|
Der
schwärzeste Tag für
den Bergbau im Saarland überhaupt war der 7. Februar
1962,
als bei einer
Schlagwetter-Kohlenstaubexplosion im Alsbachfeld der Grube Luisenthal 299 Bergleute ums Leben kamen.
Höchstwahrscheinlich
ging sie von einem über- und unterbauten Querschlag
aus, der nur schwach bewettert war und in dessen
Firste sich Methangas angesammelt hatte. Als
Grubengasabflammung beginnend, die im Bereich einer
Streckeneinmündung eine Schlagwetterexplosion
auslöste, kam es schließlich zu einer Reihe von
Kohlenstaubexplosionen mit verheerender Wirkung.
Die Zündursache blieb ungeklärt. Das Entzünden einer
Zigarette (es wurde Rauchzeug gefunden) oder die
Glühwendel einer beschädigten Kopfleuchte kommen am
ehesten in Betracht.
Zu diesem
Zeitpunkt waren 664 Arbeiter unter Tage, 433 von ihnen
im Explosionsbereich. Nur 61 blieben unverletzt. An
das Unglück erinnert heute ein Denkmal mit einer
Statue der heiligen Barbara (siehe Foto).
Das ganze
Land war vor Entsetzen gelähmt. Bundeskanzler Konrad
Adenauer sagte einen Tag später: "Die Gedanken des
ganzen deutschen Volkes weilen in diesen Tagen im
Saarland. Sie weilen bei den Opfern des furchtbaren
Bergwerksunglücks von gestern, sie weilen bei den
Angehörigen, bei den Hinterbliebenen
... Ich bin beauftragt, im Namen der Bundesregierung,
ich darf wohl sagen im Namen des ganzen deutschen
Volkes, heute hier zu sagen,
wie sehr unser Herz erfüllt ist von Trauer und von
Mitleid und wie wir alle helfen wollen, das Leid wenigstens zu mildern, das
so viele im Saarland betroffen hat."
Das Denkmal
Luisenthal wurde von dem Steinmetzen Karlheinz Gores
in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Karl Adolf Gores
geschaffen. (Mitteilung
von Norbert Theo Schuler)
Die beiden
Fotos des Denkmals sind von Stefan Haas,
Weiskirchen, 2007
|
|

|
|
Literatur
zum Thema Grubenungücke:
- Gerd
Schuster: 200 Jahre Bergbau an der Saar (1754-1954). Bielefeld
1955.
- Evelyn
Kroker: Grubenunglücke im deutschsprachigen Raum. 2. Auflage, Bochum 1999.
- Antweiler, Franz und Rolshoven,
Max: Im Ernstfall schneller vor Ort. 60 Jahre Hauptrettungsstelle
Friedrichsthal. In:
Bergmannskalender
1997,Seite 24.
- Paul
Burgard / Ludwig Linsmayer / Peter
Wettmann-Jungblut. Luisenthal im Februar.
Chronik einer Bergbau-Katastrophe
(ECHOLOT.
Historische Beiträge des Landsarchivs Saarbrücken,
Band 10. Herausgegeben im Auftrag der Vereinigung zur
Förderung des Landesarchivs Saarbrücken).
Saarbrücken 2012. -
Eine ausgezeichnete,
beeindruckende Dokumentation, die auch die
Vorgeschichte beleuchtet.
|
|
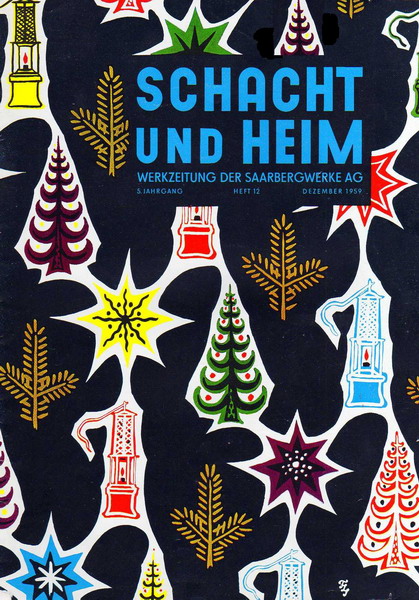
|
Der Maler
Fritz Ludwig
Schmidt
Zahlreiche Zeichnungen auf dieser Seite hat uns der saarländische
Maler Fritz
Ludwig Schmidt,
Bübingen, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt.
F. L. Schmidt hat fünfzig Jahre lang (von 1947 bis
1997) für Saarberg gearbeitet. Sein markantes
Namenszeichen ziert unzählige Zeichnungen, Skizzen und
sonstige grafische Werke aus seiner Hand in
zahlreichen Publikationen der Saarbergwerke. U.a. hat
er viele Ausgaben des Saarbrücker Bergmannskalenders
und die großformatigen
Saarberg-Kalender mit seinen Zeichnungen ausgestattet.
Schmidt hat auch für zehn Werte der saarländischen Briefmarken die Entwürfe geschaffen. Er
verstarb im Dezember 2008 im Alter von 86 Jahren.

Dieser Wandteller
mit der Signatur und dem Namen hängt neben der
Eingangstür seines Hauses in Bübingen, in dem er bis
zu seinem Lebensende gewohnt hat.
Links: Auch
das Titelbild der Weihnachtsausgabe 1959
der Werkszeitschrift Schacht und Heim wurde von F.L.
Schmidt gestaltet.
|
|
|
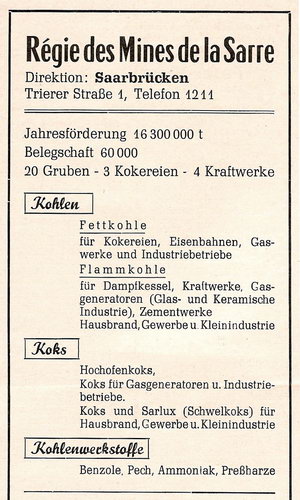
Verwendete und weiterführende
Literatur zum Saarbergbau:
- Slotta, Rainer: Förderturm und
Bergmannshaus. Vom Bergbau an der Saar. Saarbrücken
1979.
- Schneider, Gerhard: Das Revier an der
Saar und sein wechselvolles Schicksal. Geschichte des Saarbergbaus eng mit
Entwicklung des Saarlands verbunden. In:
Saarbrücker Bergmannskalender 1999, S. 21 - 32.
- Schuster, Gerd: Der Steinkohlebergbau
an der Saar.
In: Das Saarland. Ein Beitrag zur
Entwicklung des jüngsten Bundeslandes in Politik,
Kultur und Wirtschaft. Saarbrücken 1958.
- Die Kohlengruben an der Saar.
Bilder, Zahlen und Berichte über die Tätig-
keit der Régie des Mines, hrsg. von der Generaldirektion
der Saargruben 1953.
- Die Saargruben 1945-1957. 12 Jahre
französisch-saarländische Verwaltung.
- Rauber, Franz: 250 Jahre staatlicher
Bergbau an der Saar.
Teil 2: Von den Mines Domaniales
Françaises de la
Sarre bis zur Deutschen Steinkohle AG.
Sotzweiler 2003.
- Bauer, K. / K. H. Ruth: Kohle der Saar. Neunkirchen 1986.
- Mallmann,
Klaus-Michael / Steffens, Horst: Lohn der Mühen. Geschichte der
Bergarbeiter an der Saar. München 1989.
- RAG
Aktiengesellschaft (Herausgeber).
Detlef Slotta (Autor)
Der Saarländische
Steinkohlebergbau:
Bilder von Menschen, Gruben und
bergmännischen Lebenswelten. Herne, o.D.
(wahrsch. 2011).
Literaturempfehlung (sehr
lesenswert, obwohl es nicht um den Bergbau an der
Saar, sondern im Ruhrgebiet geht):
Prager,
H.G.: 1000 Meter unter Tage. Männer in Strecke und Streb. Das Buch vom
Bergbau. Stuttgt 1955; nur
noch antiquarisch erhältlich
Speziell zur
Grube Luisenthal:
Thurn, G.: Chronologie des Bergbaus im Raum
Luisenthal 1945 bis 1956. In: Völklinger
Nachkriegsjahre
1945-1956. Teil
2. Völklingen 1998. S. 50-54.
 Interessante
Weblinks: Interessante
Weblinks:
Einschlägige
Literatur zu den einzelnen Gruben findet sich im
Internet. Oftmals stellen die jeweiligen Gemeinden
ihre (ehemaligen) Grubenanlagen und die dazugehörige
Geschichte im Netz vor.
Ein
Online-Lexikon
mit sehr vielen Stichworten zum Bergbau allgemein finden Sie
unter:
http://www.miner-sailor.de/bergmannssprache.htm
Andere interessante Webseiten mit
Themen
zum Saar-Bergbau:
www.memotransfront.uni-saarland.de
- www.hschmadel.de/geschichte/geschichte.htm
-
http://www.saar-heimat.com
|
nach
oben

|
 zurück <---------> weiter zurück <---------> weiter

Home (zur Startseite) >> www.saar-nostalgie.de
|