|
|
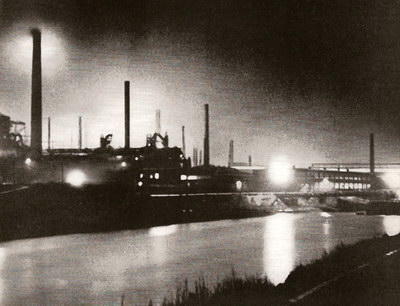
|
Die
Funken speienden Essen besichtigte schon Goethe, der bei seinem
Aufenthalt in Neunkirchen sichtlich vom dortigen Eisenwerk beeindruckt
war - nachzulesen in seiner "Dichtung und Wahrheit". Das zweite
Zitat entstammt dem Buch von Gerd Meiser und bezieht sich ebenfalls auf
das Eisenwerk in Neunkirchen. Es charakterisiert mit wenigen Worten die
Stellung und den Wert der saarländischen Stahlproduktion in den
fünfziger Jahren.
Die eisenschaffende Industrie des Saarlandes war neben dem Steinkohlebergbau der wichtigste Produktionszweig der saarländischen Wirtschaft zur Zeit der Teilautonomie. Sie
umfasste an acht Standorten fünf integrierte Hüttenwerke mit Roheisen-
und Rohstahlproduktion, Gießereien und Walzwerken, eigenen Kokereien
und verschiedenen Nebenanlagen sowie drei Warmwalzwerken ohne eigene
Stahlerzeugung. 1958 waren in dieser
Industrie ca. 33 000 Personen beschäftigt.
Der Gesamtumsatz der Hütten
erreichte annähernd ein Drittel des saarländischen Industrieumsatzes.
Die Grundlagen der Hüttenindustrie waren die saarländische Steinkohle
und die lothringische Minette (Eisenerz).
|
|
Unmittelbar
nach dem Krieg wurden fast alle saarländischen Hüttenwerke unter
französische Sequesterverwaltung gestellt. Frei arbeiten konnten nur
die Burbacher Hütte, weil sie zum luxemburgisch-belgisch-französischen Arbed-Konzern gehörte, und die Halberger Hütte,
an der die lothringische Pont-à-Mousson-Gruppe
mehrheitlich beteiligt war. Die anderen Werke wurden erst 1951 bzw.
1955/56 an ihre bisherigen Besitzer zurückgegeben.
|
|
In den verschiedenen Hüttenwerken wurden folgende Produkte gefertigt:
Hauptprodukte:
Blöcke, Halbzeug, Spezialprofile, Bandeisen, Eisenbahnschienen,
Walzdraht, Werkzeugstahllegierungen, rostfreie und feuerfeste Stähle
und Schmiedeprodukte.
Nebenprodukte: Thomasmehl, Zement, Schlackensteine, Teer, Öle und Benzole, Ammoniak, Lacke und andere chemische Erzeugnisse.
Das Bild zeigt hinten die Völklinger Hütte; vorne rechts die Schlote des Blechwalzwerks Hostenbach.
|

|
|
In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
setzte in der saarländischen Hüttenindustrie ein im Vergleich zu
anderen Revieren überfälliger Investitionsanstieg ein. Dies war der
Beginn eines Wandels in den saarländischen Hüttenwerken. Er kam aber zu
spät, um die Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen, und reichte
nicht mehr aus, um der Investitionsquote eisenschaffender Industrie in
Lothringen, Luxemburg, Nordrhein-Westfalen und Belgien gleichzukommen.
Doch
selbst wenn der Wandel früher eingesetzt hätte, hätte er nicht
vermeiden können, dass die Stahlindustrie etwa zehn Jahre später durch
die beginnende Stahlkrise einer schmerzhaften Restrukturierung entgegen ging. Nur das Werk in Dillingen konnte sich als integriertes
Hüttenwerk (bis heute) halten.
B) Metallurgische Randbedingungen der saarländischen Hüttenindustrie
(Text: Karl Presser)
In der Wiederaufbauphase nach 1945 kamen die Grundstoffe für
die saarländische Schwerindustrie wieder zollfrei aus dem französischen
Wirtschaftsgebiet.
Das
lothringische Eisenerz ("Minette") hatte einen Eisengehalt von nur rund
30% und war mit bis zu 1,7% Gewichtsanteil reich an Phosphor (bei
schwedischem Erz war im Vergleich dazu der
Eisengehalt doppelt, der Phosphoranteil aber nur halb so hoch). Das
Roheisen, das in den Hochöfen mit Hilfe von Koks
und Zuschlagstoffen aus der Minette erschmolzen wurde,
konnte in großem Maßstab nur in den (um 1880 eingeführten)
Thomas-Konvertern zu
Stahl weiterverarbeitet werden. Sie hatten Düsen im Boden, durch die
Luft
geblasen wurde, und waren mit Dolomit ausgemauert.
 Thomasstahl war relativ kostengünstig zu erzeugen. Thomasstahl war relativ kostengünstig zu erzeugen.
Er ist allerdings schlechter schweißbar als andere Stahlsorten und neigt zum Verspröden. Für die während der
Wiederaufbauphase im Saarland benötigten Beton- und Baustähle war er gut
geeignet. Eine Einschränkung für die
Hütten an der Saar war, dass aus
saarländischer Kohle allein kein Hochofenkoks erzeugt werden konnte. Der Koks war zu bröselig. War bis Kriegsende
Fremdkohle aus dem Ruhrgebiet in den Kokereien zugemischt worden, so musste man
jetzt auf Magerkohle aus Nordfrankreich zurückgreifen. Der Anteil an Fremdkohle im Saar-Hüttenkoks pendelte sich bei 20
bis 25% ein. Dieser Koks war trotzdem nicht besonders fest und daher nicht gut
zu lagern und zu transportieren. Seine mangelnde Stabilität begrenzte auch die
mögliche Größe (Höhe) der Hochöfen. Es kann nur gut “stückiges“ Material als
“Möller“ (Gemisch aus Erz, Koks und Zuschlagstoffen) bei der Roheisenerzeugung eingesetzt werden,
weil sowohl die Verbrennungsluft als auch die entstehenden Gase den Hochofen
nach oben durchströmen müssen.
Das
Foto oben zeigt die Völklinger Hütte mit ihrem Rohstofflager im
Vordergrund. Es war auf dem Gelände des heutigen Blasstahlwerks
angelegt. (Voelklingen 1948-1955 27-0174a; gemeinfreie amerikanische Archivaufnahme aus wikimedia)
Zur Erzeugung von 1000 t Roheisen mit Minette benötigte man
etwa 3000 t Erz und 900 t Koks, der aus
1250 t Kohle hergestellt werden musste.
Ab Mitte der 1960er Jahre ging die Thomasstahl-Produktion weltweit rasch zurück. Grund dafür waren wesentlich effizientere
Konverterverfahren, die statt Luft reinen Sauerstoff mit einer Lanze auf die Schmelze aufbliesen.
C) Die einzelnen saarländischen Hüttenwerke und ihre Geschichte (Texte: Stefan Haas)
|
|
1) Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke Völklingen
|
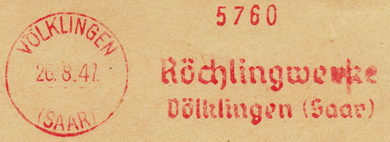
|
|
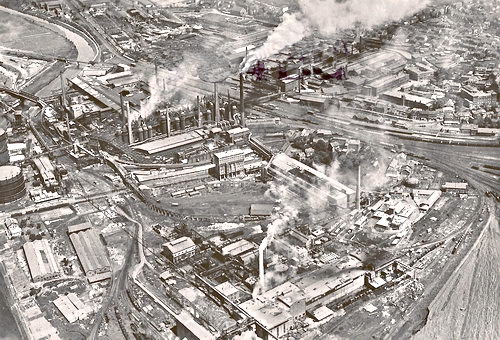
|
Die Völklinger Hütte war nach Beschäftigtenzahl und Umsatz eines der bedeutendsten Unternehmen in den fünfziger Jahren.
Sie
wurde 1873 als Völklinger Eisenhütte, Aktien- gesellschaft für
Eisenindustrie, mit einem Kapital von 500 Tsd. Talern gegründet. 1881 wurde sie von der Familie Karl Röchling gekauft.
Unter der neuen Führung konnte sie in den folgenden Jahren zu einer auf
Grund seiner Edelstähle weltbekannten Firma ausgebaut werden.
Schon zu
diesem Zeitpunkt galt die Hütte als größter Eisenträger-Hersteller
Deutschlands.
1890
wurde das Thomasstahlwerk in Betrieb genommen, 1915 das
Martinstahlwerk. 1898 übernahm Hermann Röchling
die Hütte von seinem Vater. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Werk
fast unbeschadet - alliierte Bombardierungen unterblieben
weitestgehend, eigene Zerstörungen durch die deutsche Wehrmacht im
Sinne des Nero-Befehls erfolgten gar nicht. Hier wurde bis zur letzten
Minute, also bis zum Eintreffen der Amerikaner, produziert.
|
|
1952
erreichte das Werk, bedingt durch den Bauboom und den allgemeinen
konjunkturellen Aufschwung der Nachkriegszeit, wieder die Höhe seiner
Produktion vor dem Krieg. In der zweiten Hälfte der 50er-Jahre
arbeitete es an seiner Kapazitätsgrenze. Mitte der fünfziger Jahre
hatte die Völklinger Hütte etwa 13 000 Arbeiter und Angestellte. Zu
jener Zeit waren im Bereich der Eisen- und Stahlerzeugung sechs
Hochöfen, fünf Thomas- Konverter,
drei Siemens-Martin-Öfen und ein Elektrostahlwerk mit Lichtbogen- und
Induktionsöfen in Betrieb.
Die
Walzwerke verfügten über 14 Warm- und Kaltwalzstraßen. Es standen
außerdem zwei Kokereien mit insgesamt sieben Batterien - davon eine in
Altenwald mit zwei Batterien -, ein Zementwerk, eine Schlackenmühle und
ein Benzolwerk zur Verfügung.
Erst 1956 erhielt die Industriellenfamilie Röchling das Werk aus der Sequesterverwaltung zurück.
Das
Foto (oben) von der Völklinger Hütte aus den 50er-Jahren stammt von der
Amateurfunk-QSL-Karte von 9S4BU, Rolf Loose, Altenkessel.
|
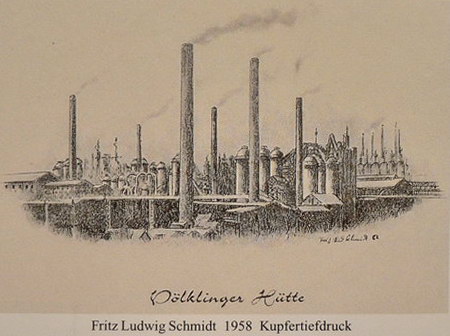
|
|
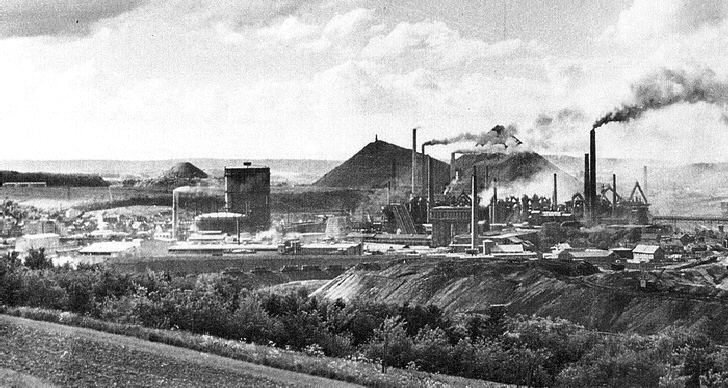
Das Hüttengelände um 1950
|
|
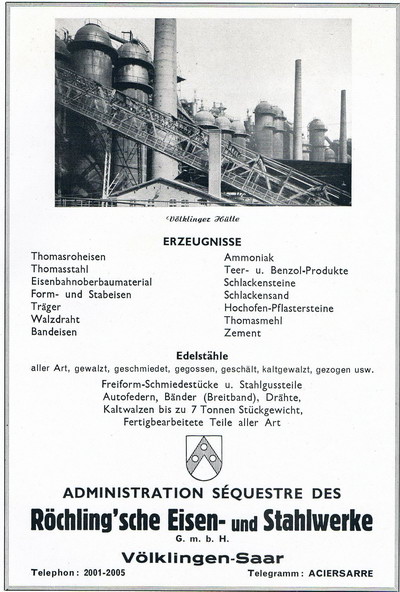
|
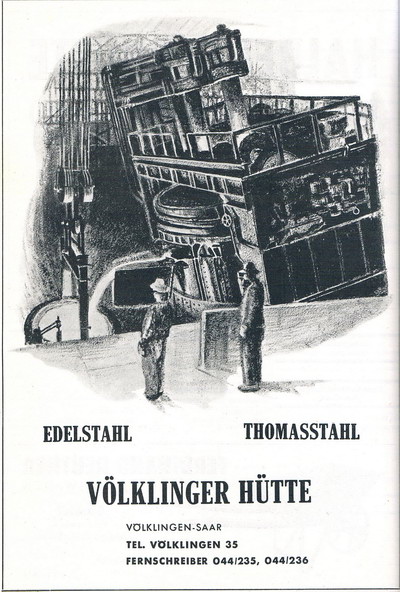
|
|
Werbung von 1949
|
Werbung von 1956
|
|
Bild unten: Die weiße Kurve zeigt die Entwicklung der Rohstahl-Erzeugung (in to = Tonnen) auf der Völklinger Hütte zwischen
1938 (ganz links) und 1956 (rechts oben) an. - 1945 (bei Kriegsende, links ganz unten) war sie auf ihrem Tiefststand.
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
2) Burbacher Hütte
Die
Burbacher Hütte ist wie die Völklinger Hütte eine Schöpfung jüngeren
Datums und wurde 1856 als "Saarbrücker-Eisenhütten-Gesellschaft"
gegründet. Der erste Hochofen wurde 1875 unter Feuer gesetzt und
vorwiegend mit luxemburgischen Erzen beschickt. Burbach arbeitete als
erstes saarländisches Werk mit eigener Koksbasis.

Da erhebliche Kriegsschäden zu verzeichnen waren, lief die Roheisen-Produktion nach dem Krieg erst ab Ende
1946 wieder an. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs kam das Werk zu erneuter Blüte. - Auch das Blechwalzwerk in Hostenbach gehörte zur Burbacher
Hütte.
|
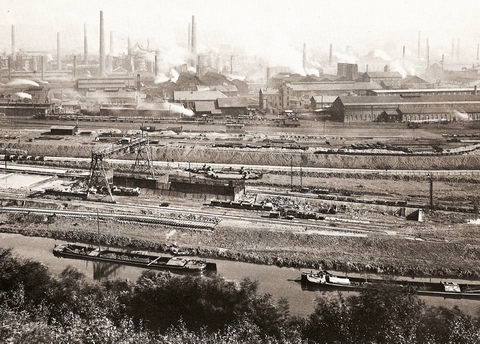
|
|

|
3) Dillinger Hütte
Die Dillinger Hütte wurde schon 1685 im Auftrag des Sonnenkönigs Ludwig XIV.
vor den Toren der Stadt Saarlouis gegründet. Im 19. Jahrhundert wurde
es zur ersten deutschen Aktiengesellschaft, und zwar im Jahre 1809.
Schon 1806 war der Betrieb um das erste europäische Blechwalzwerk
bereichert worden. Bis zu den Freiheitskriegen gegen Napoleon war die
Dillinger Hütte zeitweise ein bedeutender Blechlieferant der
französischen Armee.
Im
Zweiten Weltkrieg wurde das Werk von ca. 200 000 Granaten zu 65 %
zerstört; die Nachkriegsjahre verbrachte man mit Aufräumarbeiten, bis
man in den fünfziger Jahren wieder optimistisch der Zukunft Stahl
entgegenblicken konnte. Die nach dem Krieg eingesetzte französische
Sequesterverwaltung wurde im Jahr 1951 nach sechs Jahren aufgehoben.
(Farbfoto links: Günter Hesler, Wiebelskirchen)
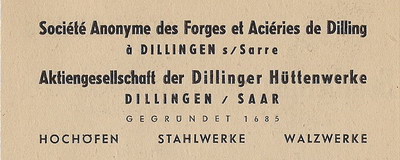
|
|

|
|

|
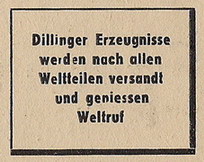
Links: Typenschild eines Behälters, 1952 auf der Dillinger Hütte gebaut. (Foto: Stefan Haas 2011 auf der Grube Reden)
|
|
4) Halberger Hütte in Brebach
Die
Hütte wurde im Jahre 1756 von dem damaligen Fürsten von
Nassau-Saarbrücken erbaut. Im Jahre 1809 haben die Gebrüder Stumm sie
übernommen. Auch dieses Werk wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1951
unter Sequesterverwaltung gestellt. Seine Jahreskapazität lag in den
fünfziger Jahren bei 200 000 Tonnen Roheisen.
Das
Hüttenwerk verfügte über sechs Hochöfen, eine Kokerei mit vier
Batterien, sechs Gießereien, ein Zementwerk, ein Kalkwerk, eine
Hochofensteinfabrik und sonstige Nebenbetriebe. Das
Produktions-programm war hier hauptsächlich auf die Erzeugung von
Gusseisen und dessen Weiterverarbeitung, unter anderem zu Röhren,
ausgerichtet. Im Jahre 1955 wurde in Brebach mit der Errichtung einer
modernen Sandschleuderanlage begonnen. Hierdurch sollte die Fabrikation
eines Spezialgusseisens mit erhöhten Festigkeitseigenschaften
ermöglicht werden.
|
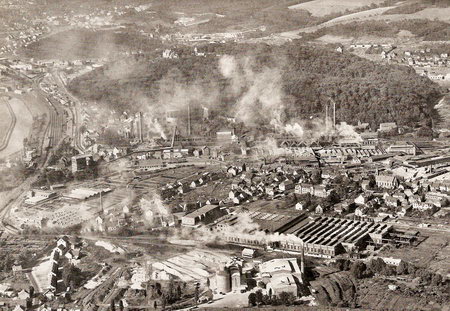
(Foto aus: Prof. Dr. F. Kloevekorn. 200 Jahre Halbergerhütte,
1756 - 1956. Saarbrücken 1956)
|
Ansichten der Halberger Hütte in den 50er-Jahren
|
5) Stahlwerk St. Ingbert (Alte Schmelz)
Dieses
Werk wurde 1733 gegründet. Im Jahre 1905 vereinigte sich das Unter-
nehmen mit dem luxemburgischen Hüttenwerk Rümelingen zur "Rümelinger
und St. Ingberter Hochofen und Stahlwerk AG".
Seit 1920 gehört das Werk
der damals neu gegründeten Aktiengesellschaft "Hauts Fourneaux et
Aciéries de Differdange St. Ingbert Rumelange" (H.A.D.I.R.) an (siehe Bild rechts!). Zu
dieser Zeit wurde die Produktion auf Drahtprodukte und Bandeisen
spezialisiert.
1955 rückte das Werk durch einen Streik der Belegschaft im Lohnkonflikt in den Blickpunkt.
Die
Drahtproduktion erfolgt bis heute durch über 100 Mitarbeiter im
Drahtwerk St. Ingbert, das 1967 mit ARBED fusionierte und seit 1993 zur
Saarstahl AG gehört.
|
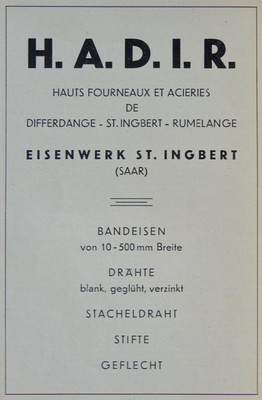
|
|
6) Neunkircher Eisenwerk
Der
große Unterschied dieses Werkes zu den anderen besteht nicht nur darin,
dass es sich völlig unabhängig von dem Bauerndorf Neunkirchen auf einer
eigenen Grundlage entwickelte, sondern vor allem in der Tatsache, dass
Pächter und Arbeiter zunächst gar nichts mit Neunkirchen zu tun hatten.
In
einer Lohnliste von 1634 sind zum ersten Mal explizit Neunkirchener, in
diesem Fall Fuhrleute, erwähnt, und erst in den folgenden Jahren
arbeiteten hier Leute aus der Umgebung, so zum Beispiel aus
Wiebelskirchen und Wellesweiler.
Es handelt sich um die älteste Hütte im saarländischen Revier; ihre erstmalige urkundliche Erwähnung verweist auf den Zeitraum des ausgehenden 16. Jahrhunderts.
|
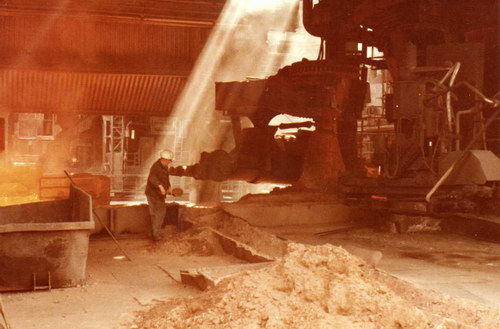
|
Zwei markante Ereignisse gilt es zu nennen, die für das Werk einschneidend
waren: Zum einen die restlose Zerstörung Neunkirchens
und seines Eisenwerks im Dreißigjährigen Krieg,
die durch einen jahrzehntelangen Neuaufbau überwunden wurde - die Hütte stand schon  früher
als das Dorf -, und zum anderen die Übernahme des Werkes durch die
Gebrüder Stumm im Jahre 1806, welche Werk und Ort in vier Generationen zu
ungeahnter Blüte brachten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die
Hütte im Rahmen der industriellen Revolution schließlich zu einem
Großbetrieb der Schwerindustrie wurde, wuchsen das Bauerndorf Neunkirchen
und das Eisenwerk zu einer Einheit zusammen.1926 übernahm
Otto Wolff aus Köln große Aktienanteile am
Neunkircher Eisenwerk. früher
als das Dorf -, und zum anderen die Übernahme des Werkes durch die
Gebrüder Stumm im Jahre 1806, welche Werk und Ort in vier Generationen zu
ungeahnter Blüte brachten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die
Hütte im Rahmen der industriellen Revolution schließlich zu einem
Großbetrieb der Schwerindustrie wurde, wuchsen das Bauerndorf Neunkirchen
und das Eisenwerk zu einer Einheit zusammen.1926 übernahm
Otto Wolff aus Köln große Aktienanteile am
Neunkircher Eisenwerk.
Im Zweiten Weltkrieg litt dieses stark unter alliierten Luftangriffen, besonders
im März 1945.
Nach dem Krieg übernahmen
die Franzosen die Sequesterverwaltung, einer der leitenden
Direktoren wurde Dr. Kurt Schluppkotten. Der Wiederaufbau
verlief schleppend, bis im Jahre 1950 im Beisein von
Johannes Hoffmann
und Gilbert Grandval sowie dessen Gattin der erste
Hochofen wieder angeblasen wurde (Fotos von diesem Ereignis finden Sie hier auf dieser Website.)
Am 13. Oktober 1955 wurde die französische Sequesterverwaltung
aufgehoben. Die einstigen Besitzer, die Firma Otto Wolff und die
Stummerben, wurden wieder alleinige Inhaber; Dr. Schluppkotten (im
Volksmund "de Schlubbes" genannt) blieb Direktor. Er verwaltete das
Werk mit eiserner Hand.
Die beiden Farbfotos (oben rechts: Im Hochofenbereich,
links: Hochofenabstich) sind aus der Sammlung Karl-Heinz Janson,
Heusweiler-Dilsburg.
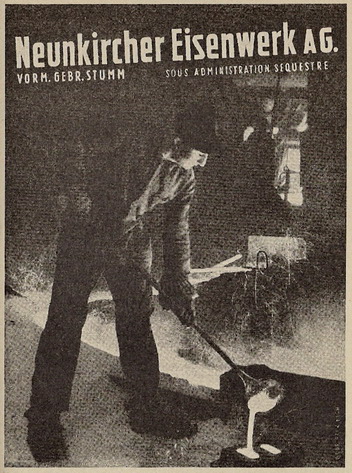 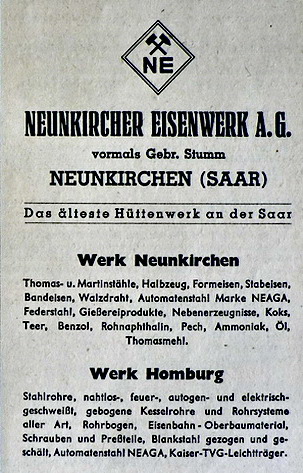
|
Literatur zu diesem Thema:
- Gnad, Franzjosef. Die saarländischen Hüttenwerke. In: Das Saarland. Ein Beitrag zur Entwicklung des jüngsten Bundeslandes in
Politik, Kultur und Wirtschaft. Saarbrücken 1958. S. 573-582.
- Meiser, Gerd. Stahl aus Neunkirchen. Saarbrücken 1982.
speziell zur Völklinger Hütte:
In
dem Buch: Völklinger Nachkriegsjahre 1945-1956 (Teil 2. Völklingen,
1998) sind folgende Abschnitte von besonderem Interesse:
- Kunkel, Ernst. Zeittafel zur Völkinger Hütte. S. 5-8.
- Müller, Heinrich. Die Hütte in den Jahren 1945-1956. S. 9-15.
- Becker, Frank. Wem gehört die Hütte? Besitzfragen 1945-56. S. 26-37.
- „Alle Räder stehen still“ – Gewerkschaftsleben und der Streik 1955. S. 38-46.
zu H.A.D.I.R. St. Ingbert:
Die Geschichte dieses Werkes finden Sie auf dieser Website: http://www.alte-schmelz.de/Ansicht/Hauptseiten/_Geschichte.htm
|
|