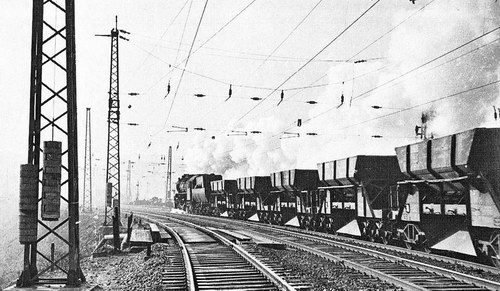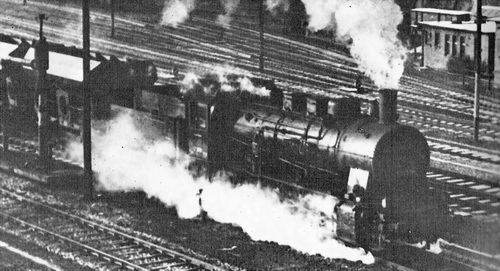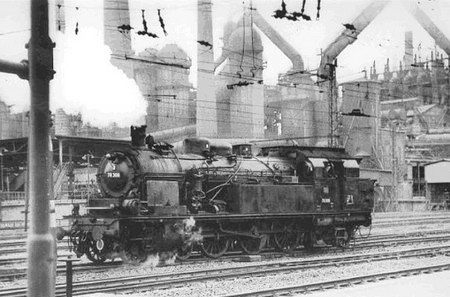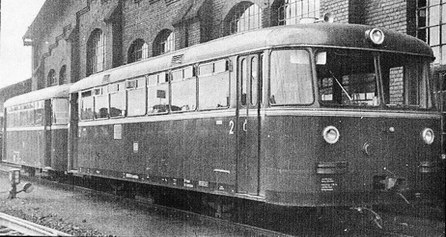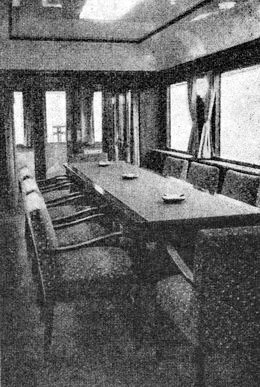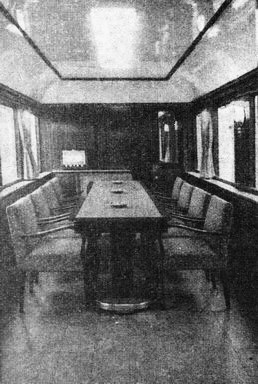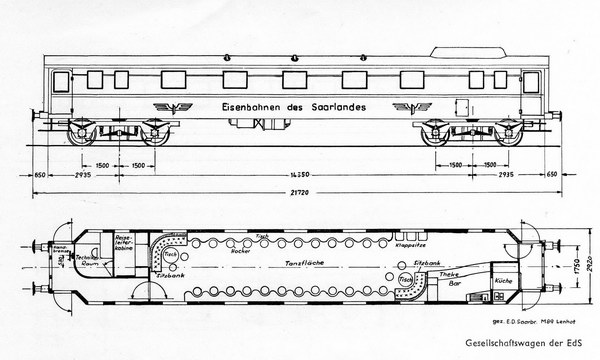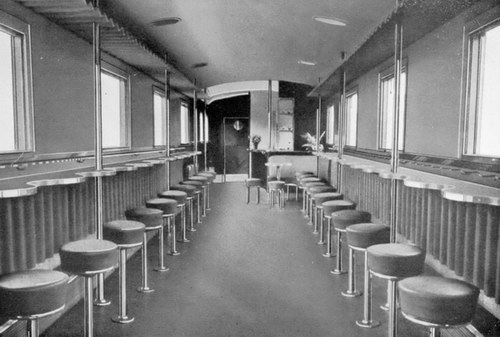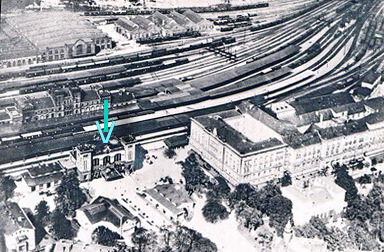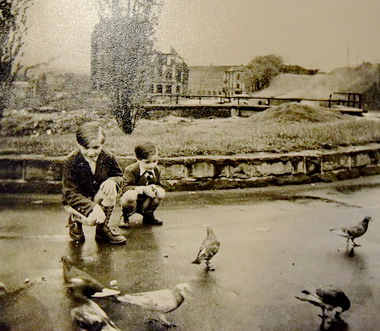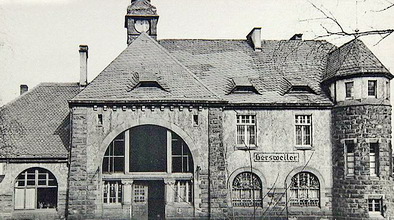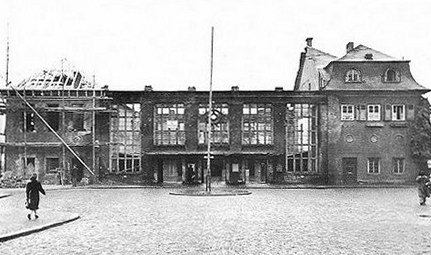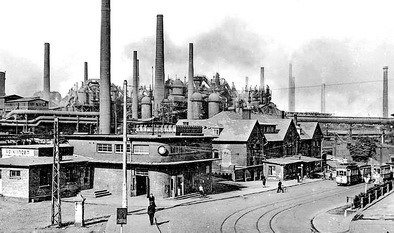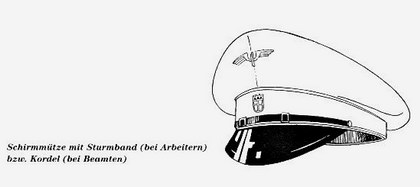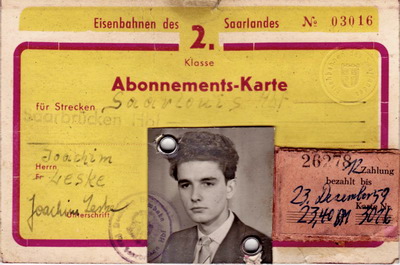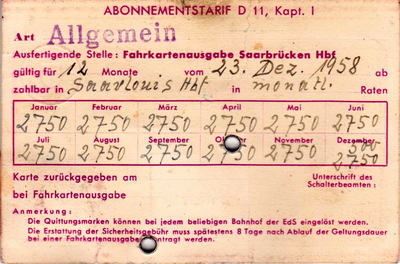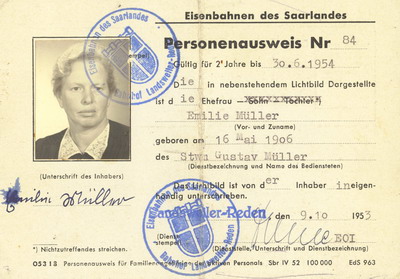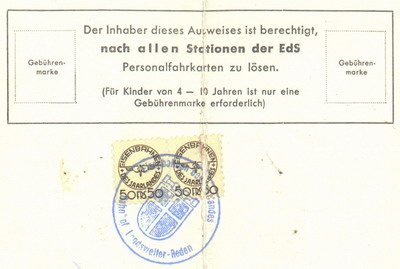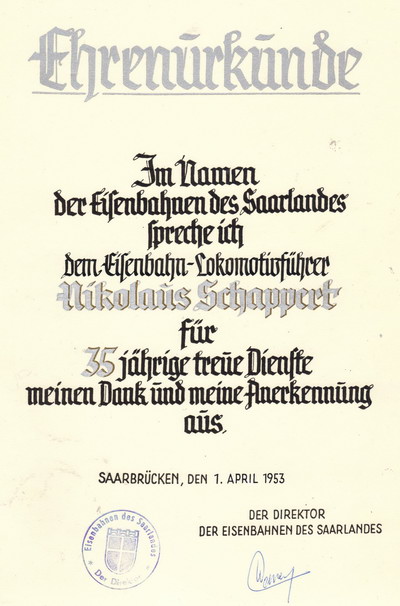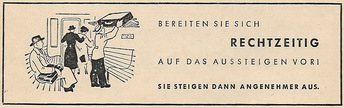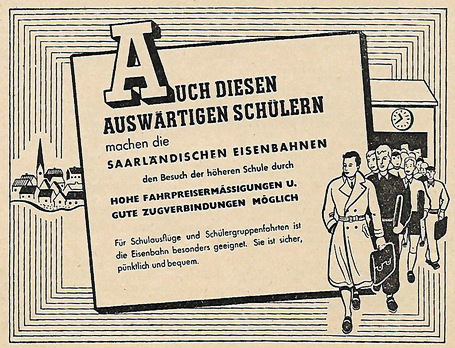|
oben
|
Home (zur Startseite) >
www.saar-nostalgie.de
|
|

|
Eisenbahnen
in
der Saarstaatzeit
1)
SEB / EdS (staatlich)
von Karl Presser und Rainer Freyer
> zur Seite
2)
Die private Merzig-Büschfelder
Eisenbahn
|
Bild oben: Lok 38 2379
im Jahr 1951 mit einem Personenzug (Foto: Georg Dollwet); mehr zu der Lok
gibt es weiter unten im Abschnitt F).
Auf dieser
Seite finden
Sie Informationen über die staatlichen saarländischen
Eisenbahnen nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa 1960.
> zu
unserer Seite über die große Ausstellung "Aus 100 Jahren Post und Eisenbahn von 1952 im Bexbacher
Blumengarten"
>
Omnibusse der Eisenbahn finden Sie auf der
Seite
Omnibusse 1
unter
Nr. 3) Bahnbusse.
> zur
Übersichts-Seite unseres
Kapitels
VERKEHR
> zur
Seite Loktransport (mit Bildern und Erläuterungen zum
außergewöhnlichen Transport einer Lok mitten durch
Völklingen 1946)
A)
Vorgeschichte: Wie die Eisenbahn ins Saarland kam
Die ersten
Eisenbahnen wurden von Dampflokomotiven gezogen. Etwa
1820 begannen in Deutschland die ersten Versuche mit
mehr oder weniger untauglichen Loks. Im Dezember 1835
fuhr auf der Bayerischen Ludwigsbahn zwischen Nürnberg
und Fürth die erste deutsche Eisenbahn. Ihre
Lokomotive trug den Namen "Adler".
Schon bald
danach kam die Eisenbahn auch in die Gegend des
heutigen Saarlandes. Grund für ihre frühzeitige
Einführung waren unsere reichen Kohlevorkommen. Die
Kohle wurde im Zuge der gegen Ende des 18.
Jahrhunderts begonnenen Industrialisierung dringend
gebraucht. Für den Transport des schwarzen Goldes
verwendete man zunächst Pferdewagen, später
Pferdebahnen mit hölzernen Schienen und Schwellen.
Doch dann begann der Siegeszug der Dampfeisenbahn.
 Man begann mit dem Bau der Strecke von
Ludwigshafen durch die Pfalz nach Saarbrücken, und im
Juli 1848 erreichte zum ersten Mal eine Dampflok, von
Kaiserslautern kommend, bei Homburg das Gebiet des
heutigen Saarlandes. Die Strecke wurde nun zunächst
bis Bexbach weitergebaut, und im Juni 1849 zog
erstmals eine Dampflok einen Zug vom neu erbauten
Bahnhof Bexbach aus nach Homburg (siehe Bild
rechts). Im August 1849 war schließlich die
ganze Strecke von der Rheinschanze bei Ludwigshafen
bis Bexbach durchgehend befahrbar. 1852 wurde die
Strecke von Metz über Saarbrücken nach Neunkirchen
eröffnet, und schon 1860 waren auch die Verbindungen
von Saarbrücken nach Trier und durch das Nahetal nach
Kreuznach fertiggestellt. (Bild: Modellbahnfreunde Bexbach e.V.) Man begann mit dem Bau der Strecke von
Ludwigshafen durch die Pfalz nach Saarbrücken, und im
Juli 1848 erreichte zum ersten Mal eine Dampflok, von
Kaiserslautern kommend, bei Homburg das Gebiet des
heutigen Saarlandes. Die Strecke wurde nun zunächst
bis Bexbach weitergebaut, und im Juni 1849 zog
erstmals eine Dampflok einen Zug vom neu erbauten
Bahnhof Bexbach aus nach Homburg (siehe Bild
rechts). Im August 1849 war schließlich die
ganze Strecke von der Rheinschanze bei Ludwigshafen
bis Bexbach durchgehend befahrbar. 1852 wurde die
Strecke von Metz über Saarbrücken nach Neunkirchen
eröffnet, und schon 1860 waren auch die Verbindungen
von Saarbrücken nach Trier und durch das Nahetal nach
Kreuznach fertiggestellt. (Bild: Modellbahnfreunde Bexbach e.V.)
Zu Beginn des
20. Jahrhunderts war Deutschland bereits mit einem
engmaschigen Netz an Eisenbahnverbindungen überzogen.
Damit konnte man nun schnell und bequem reisen. Bis
zum Beginn des Ersten Weltkriegs waren die Eisenbahnen
an der Saar ein wichtiger Teil des preußischen
Eisenbahnnetzes. Im Krieg diente die Eisenbahn aber
praktisch nur noch militärischen Zwecken.
Zwischen den
Weltkriegen weitete sich der Eisenbahnverkehr wieder
aus, obwohl auf Grund der wachsenden Ausbreitung des
Kraftfahrzeugs als Massenverkehrsmittel einige
Eisenbahnstrecken in den 30er-Jahren schon wieder
stillgelegt werden mussten.
|
|
|
|
B)
Im Zweiten Weltkrieg und in der ersten Zeit danach
Der Krieg
begann im Saarland 1939 mit einer ersten
Evakuierungswelle. Dazu bot das vorhandene
Eisenbahnnetz die besten Transport-Möglichkeiten.
Die meisten Menschen wurden nicht in Reisezugwagen,
sondern in gedeckten Güterwagen nach
Hessen, Franken und Thüringen gefahren und
nach etwa einem Jahr wieder zurückgebracht. Im
weiteren Verlauf des Krieges nutzte wiederum
hauptsächlich das Militär das Bahnnetz. Soldaten und
Unmengen von Material waren zu transportieren.
1944 mussten
die Menschen anlässlich der zweiten Evakuierung
wiederum aus dem Saarland ins Landesinnere des
Reichs befördert werden. Die Züge fuhren wegen der ständigen
Bombardierungen nur noch nachts und erreichten ihre
Ziele in Hessen und Bayern meist erst nach Tagen.
Zerstörte Bahnhöfe wurden nach Möglichkeit über
Ausweichstrecken umfahren.
Ab Mitte des
Jahres 1944, ein Jahr vor dem offiziellen
Kriegsende, konnte von einem geregelten Bahnbetrieb
im Saarland nicht mehr die Rede sein. So
wurde z. B. am
27. August 1944 der Dillinger Bahnhof bei
einem Jabo-Angriff auf einen dort abgestellten Munitionszug in
eine Trümmerwüste verwandelt. Auch die anderen
saarländischen Bahnhöfe wurden schwer beschädigt. Am
27. Mai und am 5. Oktober 1944 erlitten die
Saarbrücker Bahnanlagen so schwere Treffer, dass für
jeweils über eine Woche lang kein Durchgangsverkehr
mehr möglich war. Man
fragt sich, wie die Eisenbahner es auch nach den
schwersten Zerstörungen immer wieder schafften, in
kurzer Zeit einen Notbetrieb möglich zu machen.
In den
letzten Kriegsmonaten ist der größte Teil der
Eisenbahnanlagen (Strecken, Brücken, Tunnel und
Bahnhöfe) zerstört worden, entweder von deutschen Soldaten
auf dem Rückzug oder von den einmarschierenden
alliierten Truppen. Anfang 1945 wurden im Saartal
schwerste Kämpfe ausgetragen, in vielen Orten die
Bahnanlagen vollkommen in Trümmer gelegt sowie
Tunnels und zahlreiche Brücken gesprengt.
|
|
Die
schweren ersten Jahre nach dem Krieg (1945/46)
Als am 21.
März 1945 die Städte Saarbrücken und Neunkirchen von den
Amerikanern besetzt wurden, schwiegen die Waffen im
Saarland endgültig. Die Gleisanlagen waren
vielerorts völlig verwüstet. Keine Hauptstrecke war
mehr durchgehend befahrbar - siehe nachfolgend
abgebildete Karte: Die
Kreuze auf den Strecken markieren zerstörte
Abschnitte. (Karte
aus: Kurt Harrer, Eisenbahnen an der Saar, Seite
81.)
|
|
Im Saarbrücker Hauptbahnhof soll keine der noch
vorhandenen Schienen länger als zwei Meter gewesen sein.
Insgesamt waren im Saarland über 400 Kilometer, also
etwa ein Viertel der bis dahin bestehenden Gleisanlagen, 40% aller Weichen, 226 Brücken, 27 Tunnel und fast 90 % der Bahnhöfe zerstört. Die Hälfte der vorhandenen Lokomotiven wiesen schwere bis schwerste
Schäden auf; ein ähnliches Bild zeigte sich bei den
Wagen.
Aber noch vor
dem offiziellen Waffenstillstand am 8. Mai 1945
hatten amerikanische Feldeisenbahner einige
Verbindungen schon wieder hergestellt. Es gelang
ihnen z.B., ein Gleis von Saarbrücken über Sulzbach,
Neunkirchen, Homburg und Bad Münster am Stein nach
Kaiserslautern und bis Mainz wieder in befahrbaren
Zustand zu versetzen. Kleinere örtliche deutsche
Verwaltungsorganisationen durften nun damit
beginnen, Gleise wiederherzustellen und verstreute
Lokomotiven, Wagen und sonstiges Material
einzusammeln.
|
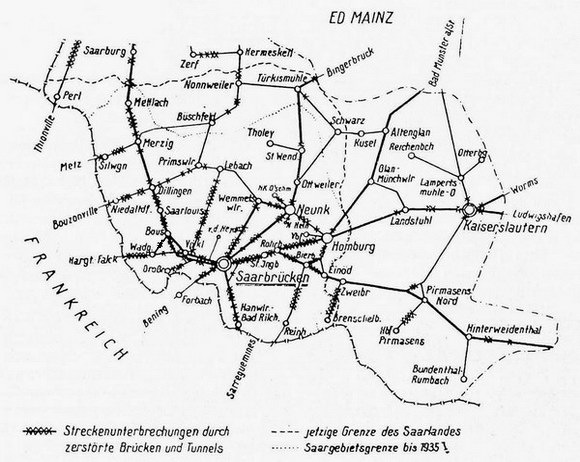
|
|
So wurde im
Saarland in erstaunlich kurzer Zeit und unter
denkbar ungünstigen Bedingungen ein Eisenbahnverkehr
in bemerkenswertem Umfang wieder in Gang gebracht. Eine
einheitliche Eisenbahnverwaltung gab es zunächst
noch nicht. Anfangs hatte das US-Militär die
Bahnaufsicht inne. Sie ging am
10. Juli 1945 auf die Franzosen über, nachdem diese
den linksrheinischen Teil der amerikanischen
Besatzungszone übernommen hatten. Sie gründeten das
"Détachement d'Occupation des Chemins de Fer
Français" (DOCF) mit Sitz in Speyer.
Im Juni/Juli
1945 veranlassten sie den Wiederaufbau der Reichsbahndirektion
(RBD) Saarbrücken. Deren neuer Präsident, Dr.
Karl Fischer, war an die Weisungen des DOCF
gebunden. Da er dieser Forderung häufig nicht
nachkam, wurde er aus dem Saarland ausgewiesen,
nachdem die Reichsbahndirektion Saarbrücken am 31.
Juli 1946 endgültig aufgelöst worden war.
An solchen
rigorosen Maßnahmen konnte man erkennen, wie
entschlossen die Franzosen vorgingen, um ihre
Vorstellungen über die Zukunft der Saar
durchzusetzen. Am 1. August 1946 entstand als
Nachfolgerin der Saarbrücker RBD die neue Eisenbahndirektion
Saarbrücken. Sie war bis zum 31. März
1947 für die Belange der Bahn zuständig. Während
dieser Zeit wurde der Wiederaufbau des
Streckennetzes vorangetrieben. So war zum Beispiel
ab 26. August 1946 die Stadt Trier wieder mit dem
Zug erreichbar, nachdem der Mettlacher Tunnel
instand gesetzt worden war. [1]
------------------------------
[1] Siehe
Hudemann - Heinen. Das Saarland zwischen
Frankeich, Deutschland und Europa. S. 104.
C)
1947 bis 1951: Saarländische
Eisenbahnen
(SEB)
In
der
amerikanischen und der britischen Besatzungszone
schlossen sich die
Eisenbahnen bereits 1946 unter dem Namen „Deutsche
Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsgebiet“
zusammen. Der Sitz ihrer Hauptverwaltung befand sich
in Offenbach am Main.
Dem
Eisenbahnwesen im Saarland gab die französische
Besatzungsmacht am 1. April 1947 eine eigene
Verwaltung unter dem neuen Namen Saarländische
Eisenbahnen (SEB), Eisenbahndirektion
Saarbrücken. Für den nördlich des Saarlandes
gelegenen Teil der Französischen Zone wurde die neue
Eisenbahndirektion Trier gebildet, die ab 25. Juni
1947 ebenso wie die Direktionen Mainz und Karlsruhe
der „Betriebsvereinigung der
Südwestdeutschen Eisenbahnen“
(SWDE) in
Speyer unterstand.
Die
SEB erhielt folgende Organisationsstruktur:
|
|
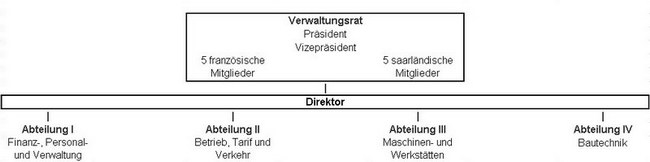

Das Emblem
der SEB setzte sich aus den symbolisch zu einem Rad
geformten Buchstaben S, E und B zusammen.
Die
Aufsichtsbehörde DOCF wurde ab 1. Januar 1948
organisatorisch geteilt. Die für die SEB zuständige
Einheit führte den Namen „Mission technique des
Chemins de Fer de la Sarre“ (MTCF). Sie siedelte
sich in Saarbrücken in einer Villa am Staden an.
Damit war eine vollständige Abspaltung der
saarländischen Eisenbahnverwaltung von derjenigen
der übrigen Französischen Zone vollzogen. Nach der
Ausweisung von Dr. Karl Fischer im Juli 1946 (siehe
vorletzten Absatz von B) hatte Bernhard Meilchen die
Leitung der SEB kommissarisch als „Alterspräsident“
übernommen. Von Mitte 1948 bis 1950 war Colonel
Pierre Toubeau Direktor der SEB. Ihm folgte der
Zivilist Joseph-Nicolas Werner aus Lothringen. Alle
Abteilungsleiter waren ebenfalls Franzosen. Mit der
technischen Oberaufsicht über die SEB wurde die SNCF
betraut.
Die fortlaufenden personellen
Veränderungen hatten lediglich politische und
verwaltungstechnische Bedeutung.
Die eigentliche
Herausforderung der SEB war aber weiterhin die
Behebung der Kriegsschäden.
|
Die
größten Schwierigkeiten gab es mit dem
Schienennetz, der Signaltechnik, dem
bahneigenen Fernmeldewesen und den
zerstörten Bauwerken der Infrastruktur wie
Bahnhöfe, Betriebswerke, Brücken und
Stellwerke. Die abrückenden deutschen
Truppen hatten kurz vor dem Kriegsende
nicht nur
Gebäude, sondern auch Gleisanlagen mit in
kurzen Abständen gelegten Ladungen
gesprengt.
Bild
rechts:
Vier Dampfloks bei einer Belastungsprobe
der neuen Kleinbahnbrücke bei
Saarlouis-Lisdorf 1949. Jede neue oder
wiederaufgebaute Brücke muss einen
Belastungstest mit mehreren Lokomotiven
bestehen, bevor sie für den
Eisenbahnverkehr freigegeben wird.
(Foto:
Volker Felten)
|

|
|
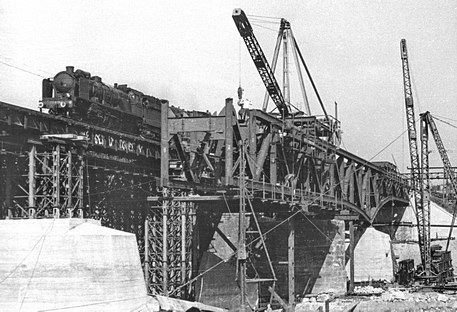
Wiederaufbau
der Achterbrücke am Saarbrücker
Schanzenberg
Foto:
© Walter Barbian:
http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu
|
Erschwerend
kam hinzu, dass Gleis- und Oberbaumaterial
als Reparationsleistung nach Frankreich
geliefert werden musste, hatten doch die
Deutschen ihrerseits während der
Besatzungszeit nach 1940 französische
Gleisanlagen demontiert und in Russland
verbaut. Manche Strecken waren deshalb
jetzt nur noch eingleisig.
Um
möglichst viele Abschnitte befahrbar zu
machen, wurden auch französische Weichen
eingebaut. Diese waren allerdings anders
konstruiert als die deutschen. Daher
verursachten sie später, am Anfang der
60er Jahre, als die Geschwindigkeiten und
Zuggewichte angestiegen waren, einige
Entgleisungen, die jedoch mehr oder
weniger glimpflich verliefen.
Gleichzeitig
mit der Zollgrenze zu Deutschland
wurden am 22. Dezember 1946 acht
Zollbahnhöfe eingerichtet. Reisende
mussten zur Pass- und Zollkontrolle die
Züge anfangs verlassen, später fand die
Überprüfung in D- und Eilzügen auch
während der Fahrt statt.
|
Das rollende
Material der SEB konnte von diesem Zeitpunkt
an nur noch in den
saarländischen Ausbesserungswerken St. Wendel
(Dampflokomotiven) und Saarbrücken-Burbach (Wagen)
instand gesetzt werden. Zusätzlich war die
Beschaffung von Ersatzteilen für die aus deutschen
Fabriken stammenden Lokomotiven äußerst schwierig
geworden. Zum Glück waren aber die bestehenden
Ausbesserungswerke für eine Überarbeitung von
Lokomotiven und Wagen ausgelegt.
Die
metallverarbeitende Saarindustrie stand außerdem
schon wieder als Zulieferer für Ersatzteile zur
Verfügung. Die Materialknappheit war jedoch immer
noch ausgeprägt. So mussten zeitweise bei Schäden an
den Lichtmaschinen der Lokomotiven statt
elektrischer Leuchten wieder Petroleumlampen
angebaut werden, weil Kupferdraht zur Reparatur der
Wicklungen fehlte. Möglicherweise wurden auch
Karbidlampen als Behelfsleuchten an den Loks
verwendet.
1947 listete
die SEB 992 Wagen für den Personenverkehr auf,
67 davon waren Reisezugwagen mit Drehgestellen. Als
einsatzfähig konnten man allerdings weniger als 600
Personenwagen betrachten; sie litten meist unter
Beschränkungen wie verbretterten Fenstern, undichten
Dächern, fehlender Beleuchtung und Heizung.
Zu privaten
Zwecken war die
Benutzung von Zügen für Reisen unter 30 km
Entfernung zunächst vollständig untersagt. Daher
fand der Personenverkehr kurz nach Kriegsende oft
als verbotene „Hamsterfahrt“ in Güterwagen und auf
den Trittbrettern oder Dächern der wenigen
Personenzüge statt. Die nur in geringer Zahl
vorhandenen Schnellzugwagen hatten wie in allen
Besatzungszonen auch bei uns zunächst die Organe der
Siegermächte in Beschlag genommen. Für die selten
verkehrenden Schnellzüge benötigten Reisende nicht
nur Fahrkarten, sondern zusätzlich Zulassungskarten.
Außerdem war das Mitführen von Lasten verboten.
|

|
In
den Bestandslisten der SEB wurden 1947
insgesamt 341 Dampflokomotiven geführt. Für
Güterzüge waren überwiegend Lokomotiven der
Baureihen 42 (25 Stück), 50 (80 Stück) und
57 (81 Stück) vorhanden, für Personenzüge
wurden Lokomotiven der Baureihe 38 (50
Stück) sowie Tenderlokomotiven der Baureihen
78 (32 Stück) und 86 (15 Stück) verwendet.
Maschinen weiterer Baureihen komplettierten
mit kleineren Stückzahlen den Bestand.
Schwere Schnellzuglokomotiven standen nicht
mehr zur Verfügung. Immerhin waren 68% des
Lokomotiv-Bestandes betriebsfähig. In der
übrigen französischen Zone traf dies nur auf
45% der Triebfahrzeuge zu.
(Näheres
über die verschiedenen
Lokomotiv-Baureihen finden Sie weiter
unten im
Abschnitt
F.)
Im
Personen-Nahverkehr bildete die Baureihe 78
das Rückgrat. Diese Loks konnten sowohl
vorwärts als auch rückwärts bis zu 100 km/h
schnell fahren.
|
Zum Bild
oben: Die Lok 78 317 mit Lokführer und Heizer in
Saarbrücken im Jahr 1949. Unter der Betriebsnummer
ist das SEB-Emblem aufgemalt, unten rechts der
Name der Heimatdienststelle Bw Saarbrücken Hbf. (Foto: Oswald Kunz,
Sammlung Hansjürgen Wenzel)
Vom 7.
September 1949 an verwendete die gemeinsame
Verwaltung der Eisenbahnen in der ehemaligen
Amerikanischen und Britischen Zone den Namen „Deutsche
Bundesbahn“.
D) 1951 bis 1956: Eisenbahnen des
Saarlandes (EdS)
Aus
SEB
wurde
am 25. Januar 1951
EdS. Diese
Umorganisation war in der „Konvention zwischen dem
Saarland und Frankreich über den Betrieb der
Eisenbahnen des Saarlandes“ vom 3. März 1950
vereinbart worden (veröffentlicht am 5.1.1951 im
Amtsblatt des Saarlandes).
Mit Gründung der EdS fanden tiefgreifende
personelle Veränderungen statt: Präsident des
neuen Verwaltungsrates wurde der in Saarlouis
geborene Heinrich Welsch (er war 1955 für
einige Monate Übergangs-Ministerpräsident). Auch die Abteilungsleiter
waren jetzt Saarländer. Direktor blieb der
Lothringer Joseph-Nicolas Werner.
|
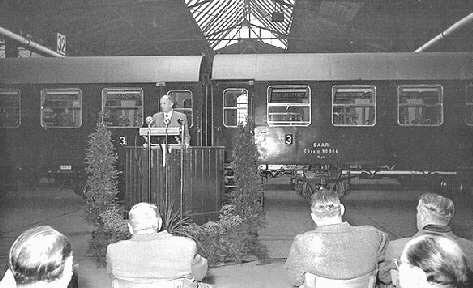
|
Als am 18. Oktober
1951 das Bundesbahngesetz in Kraft trat,
gab es in der Bundesrepublik eine
Staatsbahn. Im Saarland hatte die EdS zu
dieser Zeit 322 Lokomotiven im
Bestand; 55 davon waren jedoch als nicht
betriebsbereit abgestellt.
Bemerkenswert ist,
dass die Lokomotiven nicht mit dem
Eigentumssymbol "EdS" versehen wurden.
Stattdessen trugen sie jetzt die
Beschriftung „SAAR“. Diese Aufschrift und
die aufgemalten Ziffern der Lokschilder
waren schattiert wie bei den französischen
Loks.
Betriebswerke (Bw)
in Dillingen, Homburg, Merzig,
Neunkirchen, Saarbrücken-Hauptbahnhof,
Saarbrücken-Verschiebebahnhof, St. Wendel
und Völklingen sorgten dafür, dass die
Räder rollen konnten.
|
Foto:
Heinrich Welsch bei der Vorstellung der ersten
Umbauwagen am 27. Oktober 1954 in Burbach
© Walter Barbian
(http://www.saarlandarchiv-eu)
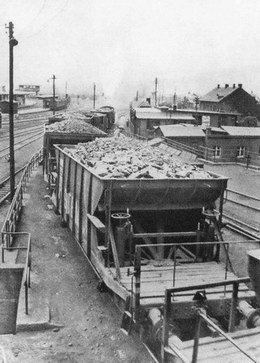
Am 1. April 1948 hatte die SEB per Dekret
alle Güterwagen zugesprochen bekommen, die
sich im Saarland befanden, unabhängig von ihrer
eigentlichen Herkunft. Ende 1951 befanden sich
daher wieder 10.596 Güterwagen im Bestand der EdS.
Darunter waren 1.000 einfach ausgestattete
Neubauwagen der Firma Gebrüder Lüttgens GmbH aus
Saarbrücken-Burbach. Sie verfügten, nach
französischem Vorbild, über stählerne Seitenwände
und wurden hauptsächlich für Kohlentransporte
eingesetzt.
Die Güterwagen deckten die
gesamte Palette an offenen und geschlossenen Wagen
ab. Offene Selbstentladewagen zum Erztransport (siehe
rechts) und offene Güterwagen zum
Kohlentransport konnten zu einheitlichen Ganzzügen
zusammengestellt werden. Erzeugnisse der Eisen-
und Stahlindustrie wie Halbzeuge, Profile, Drähte
und Bleche wurden meist per Niederbordwagen
befördert.
Statistisch gesehen erreichte Anfang der
50er Jahre mehr als die Hälfte aller Pendler die
Arbeitsstelle ganz oder teilweise mit dem
Personenzug. Daher war der Bahnverwaltung klar,
dass sie nicht nur in den Güterverkehr, sondern
auch in den Personenverkehr investieren musste.
Von 1951 bis 1953 war der Bestand an Reisezugwagen
durch 100 Vierachser der Reichsbahn aufgestockt
worden, die nach Kriegsende in Frankreich
zurückgeblieben waren.
Das Foto
zeigt einen
Minette-Erzzug
mit
vierachsigen
Selbstentlade-Wagen
beim Rangieren in Völklingen
(Foto:
Sammlung Schöpp)

|
Vorherrschend im
Wagenbestand waren alte Abteilwagen. Es
gab aber auch sogenannte 'Donnerbüchsen'
(Waggons mit Mittelgang und Plattformen an
den Stirnseiten) sowie zu
Behelfspersonenwagen umgebaute Güterwagen.
Insbesondere die alten Abteilwagen mit
hölzernen Wagenkästen waren kaum noch zu
reparieren. Österreich, Deutschland und
Frankreich legten Programme zum Umbau
ihrer Dreiachser-Abteilwagen auf.
Die EdS baute gemäß
den Konstruktionsplänen der Bundesbahn. Im
Waggonbau der Fa. Gebr. Lüttgens wurden
die Unterteile aufgearbeitet und die
stählernen Aufbauten gefertigt. Nebenan im
bahneigenen Ausbesserungswerk Burbach
wurden die Wagen komplettiert. Ab 1954
entstanden so 400 Waggons. In der 3.
Wagenklasse kuppelte man jeweils zwei
davon dauerhaft „kurz“ zusammen, um Kosten
zu sparen. Denn so konnten die
bei Einzelwagen notwendigen
Abschlussrollläden an den Stirnseiten
entfallen. Ein weiterer positiver Effekt
war die erheblich gesteigerte Laufruhe
dieser Pärchen im Vergleich zu einzelnen
Wagen.
|
|
Ab 1956 begann man,
nur noch gekuppelte Pärchen einzusetzen.
Ihre zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde
von 85 km/h auf 90, später sogar teilweise
auf 100 km/h angehoben.
Foto: © Walter
Barbian
(http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)
|
Zu
den Bildern. Oben: Der erste im Ausbesserungswerk
Burbach umgebaute Personenwagen wird mit
seiner
Beschriftung versehen.
Unten:
So entstanden die Umbauwagen in Burbach.

Wagenklassen:
Die
Personenwagen der Eisenbahnen waren
anfangs in vier Klassen aufgeteilt. Am 7.
Oktober 1928 ließ man bei der Deutschen
Reichsbahn die beliebte - weil billige -
4. Wagenklasse wegfallen. Sie hatte
ursprünglich hochklappbare Holzbänke und
wurde deshalb auch „Stehklasse“ genannt.
Grund der Abschaffung war der hohe
Instandhaltungsaufwand für die
unterschiedlich ausgestatteten Waggons.
Die 3. Wagenklasse mit ihren Holzbänken
aus stabilen Latten blieb unverändert
weiter bestehen. Die Fahrpreise
wurden jedoch gesenkt.
Aber
auch
für die drei verbliebenen Wagenklassen
erschien den Eisenbahnverwaltungen der
Wartungsaufwand bald zu hoch. Darüber
hinaus waren ungepolsterte Sitze nicht
mehr zeitgemäß. Für 1956 verständigten
sich daher fast alle europäischen
Eisenbahn-Gesellschaften auf die
Einführung eines einheitlichen Systems mit
nur noch zwei Wagenklassen. Für die
ungepolsterte 3. Klasse bedeutete das zwar
das Aus, jedoch wurde sie nicht etwa
einfach abgeschafft. Vielmehr legte man
die alte komfortable 1. Klasse mit der
bisherigen 2. Klasse zusammen und nannte
das Ganze nun "1. Klasse". Die ehemalige
3. Klasse erhielt jetzt den Namen " 2.
Klasse". So kam es, dass während einer
Übergangszeit auch in der 2. Klasse Wagen
mit Holzbänken fuhren.
Die
Umstellung der Wagenklassen verursachte
zunächst hauptsächlich Arbeit für die
Schriften-Maler in den Betriebswerken.
Neue Polstersitze erhielten nur die Wagen,
die noch längere Zeit benutzt werden
sollten. Umbauwagen waren schon in der
früheren 3. Klasse alle gepolstert.
|
|
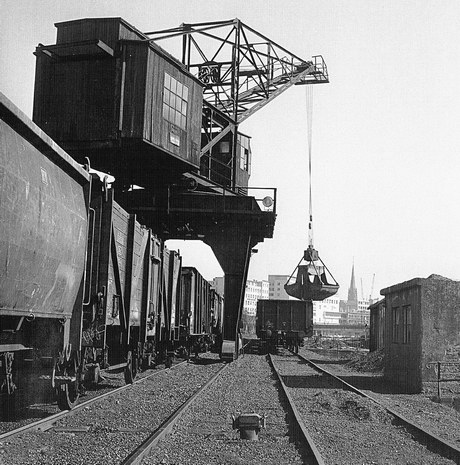
|
Da zu vielen
Betrieben im Land ein eigenes
Anschlussgleis führte, war ein
umfangreicher Rangier- und
Verschiebedienst mit
qualmenden
Rangierlokomotiven
gängige Praxis. Dabei stieg schon
1946 die Tagesleistung wieder auf mehr als
3.000 Wagen an.
Das höchste
Transportvolumen des saarländischen
Eisenbahnnetzes wies, wie schon vor dem
Krieg, die Strecke
Thionville-Bouzonville-Überherrn-Völklingen
mit ihren Erz- bzw. Kohlenzügen auf. Die
Erztransporte erreichten um 1960 ihr
Maximum. Danach sank der Minette-Einsatz
der Hütten kontinuierlich.
Eine
Elektrifizierung dieser Erzbahn und
weiterer Hauptstrecken wurde schon in den
50er-Jahren diskutiert. Dazu legte sich
die EdS auf das deutsche Bahnstromsystem
mit 16 2/3 Hz fest. Die Arbeiten daran
wurden jedoch damals noch nicht in Angriff
genommen.
1954 bestellte die
EdS bei Gebr. Lüttgens 15 einmotorige Schienenbusse
mit Beiwagen nach Vorbild der DB-Baureihe
VT-95. Lizenzgeber für die Fahrzeuge war
die Waggonfabrik Uerdingen. Sie erhielten
jedoch, abweichend von der DB-Version,
Motoren mit 130 PS von Berliet statt von
Büssing. Die EdS ließ, im Gegensatz zur
DB, sogar den Betrieb mit zwei Beiwagen
zu. 1956 erweiterte die EdS
ihren Triebfahrzeugpark durch zehn leichte
Rangierlokomotiven mit Dieselmotor. Sie
erhielten die Bezeichnung V 45
(siehe
unten im Abschnitt F).
|
Foto:
Kohleverladung auf der Hafeninsel in Saarbrücken.
Foto: © Walter
Barbian (http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)
|
Fritz
Francke
jr., heute wohnhaft in Mainz, hat uns
einen kurzen Videoclip von 1954
zur Verfügung gestellt. Er schreibt dazu:
"Mein Vater hat ihn mit seiner damals noch
neuen Schmalfilmkamera aufgenommen. Wir
waren als Kinder oft mit ihm am großen
Güterbahnhof zwischen Dudweiler Landstraße
und Rodenhof und standen dann auf der
heute nicht mehr existierenden
Johannisbrücke, die über die Gleise
führte"
Unter
folgendem Link können Sie sich den Clip
bei Youtube anschauen (90 Sek. lang): Güterzuglokomotiven
(u.a. 57 2248) beim Rangieren in
Saarbrücken 1954.
Es
sind dort auch zwei Loks der Baureihe 42 und
zahlreiche Wagen der EdS zu sehen.
|

|
|
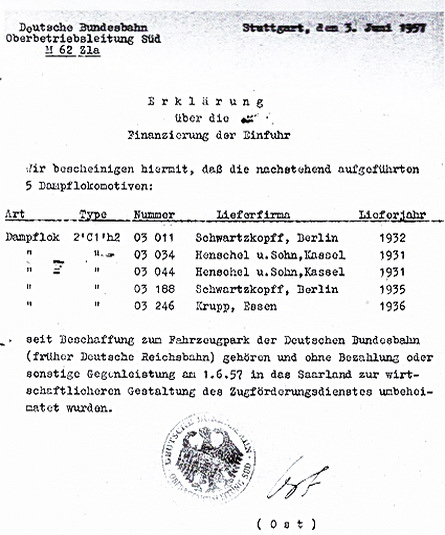 E)
1957: Aus den EdS wird die E)
1957: Aus den EdS wird die
Bundesbahndirektion
Saarbrücken
Am 1.
Januar 1957 wurden die EdS mit der
Angliederung der Saar an die Bundesrepublik
in die Deutsche Bundesbahn (DB) integriert.
So sind 330 km Haupt- und 200 km Nebenstrecken, 6.216 Beamte und 7.414 Angestellte
und Arbeiter in die DB überführt worden.
Dabei
galten dieselben Bedingungen wie beim
Übergang der Post- und Telegraphenverwaltung
in die Oberpostdirektion Saarbrücken
(siehe Seite
Post im
Saarstaat im Abschnitt c). Das gesamte Personal
der EdS wurde Personal der DB, und die
Beamten wurden unmittelbare Bundesbeamte. So
blieb der soziale Besitzstand des Personals
erhalten.
Die
Bundesbahn übernahm per 1. Januar 1957 von
der EdS 287 Dampflokomotiven, fünf bis dahin
bereits gelieferte Schienenbusse und zehn
neue Diesel-Rangierlokomotiven der Baureihe
45. Außer dem gesamten vorhandenen
Eisenbahn-Wagenbestand gingen auch 65
Bahnbusse französischer Herkunft in den
Bestand der Bundesbahn über, und es wurden
auch mehrere bundesdeutsche Lokomotiven ins
Saarland "umbeheimatet" (siehe
Schriftstück rechts!)
Die
neue Bundesbahndirektion Saarbrücken gehörte
auch nach der politischen Angliederung wegen
der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen
Verknüpfung der Saar mit Frankreich zum
französischen Zollgebiet. Daher konnte die
bisherige unbefriedigende Material- und
Instandsetzungs-Situation nicht verbessert
werden.
|
|

|
Der
neuen Bundesbahn-Direktion an der Saar stand
zunächst (bis März 1960)
der Leiter der Direktion Trier,
Prof. Dr. Fritz Grimm, kommissarisch und in
Personalunion vor. Als politisches Zeichen
erfolgte die unmittelbare Einbindung des
saarländischen Fernverkehrs in das
Reisezugnetz der DB. Mit dem vorhandenen
Bestand an Triebfahrzeugen konnten aber
keine Geschwindigkeiten über 100 km/h
gefahren und auch keine schweren D-Züge
gezogen werden. Die Idee, für den Einsatz
vor D-Zügen Lokomotiven der Baureihe 03 per
temporärer Ausfuhr nach Saarbrücken zu
bringen, ließen die Franzosen scheitern,
indem sie zunächst keine Einfuhrgenehmigung
erteilten.
Ab
Juni 1957 stimmten die französischen
Zollbehörden dann einer auf 6 Monate
begrenzten Einfuhr von fünf Lokomotiven zu.
Diese befristete Genehmigung wurde danach
alle sechs Monate ohne Probleme erneut
erteilt. Die Anzahl der Lokomotiven durfte
schließlich sogar auf sieben (einschließlich
einer Reservelok) erhöht werden.
- Foto
links:
Kinderferien
1959
(VdK-Archiv)
|
|
 Vollkommen
vergeblich war aber der Versuch der DB,
sechs Güterzug-Lokomo- tiven der Baureihe 44
schon vor dem Tag X ins Saarland zu
überstellen. Schwere Kohlenzüge mussten
daher weiterhin mit Vorspann-Lokomotive und manchmal auch
mit zusätzlicher Schiebelok durch die
Grubensenkungen auf der Sulzbach- und
Fischbachtalstrecke gezogen werden. Vollkommen
vergeblich war aber der Versuch der DB,
sechs Güterzug-Lokomo- tiven der Baureihe 44
schon vor dem Tag X ins Saarland zu
überstellen. Schwere Kohlenzüge mussten
daher weiterhin mit Vorspann-Lokomotive und manchmal auch
mit zusätzlicher Schiebelok durch die
Grubensenkungen auf der Sulzbach- und
Fischbachtalstrecke gezogen werden.
Im
Saarland florierte die Montanindustrie
weiter. 1958 betrug der im Bereich der
Direktion Saarbrücken abgewickelte Anteil am
gesamten Gütertransport der Bundesbahn dank
der vielen Kohlen- und Erzzüge fast 17 %.
Mit
seinen vielen Pendlern in Spitzenzeiten
war der Berufsverkehr an der Saar sogar
der stärkste im Bereich der DB.
Wegen
der Rückverlegung des Zolls von der
deutschen zur französischen Grenze nach dem
Tag X waren für die Güterzüge
Gemeinschafts-Zollbahnhöfe eingerichtet
worden, und zwar in Saarbrücken, Überherrn,
Saargemünd, Forbach und Apach. Die
Abfertigungen in Reinheim-Bliesbruck und
Hemmersdorf-Bouzonville blieben für DB und
SNCF getrennt.
Die
Bundesbahndirektion Saarbrücken wurde
organisatorisch der Oberbetriebs- leitung
Süd in Stuttgart zugeordnet. Der
Direktionsbereich Trier wurde aufgelöst und
wieder Saarbrücken angegliedert.
Zug
mit der Lok 03044 (Foto: Wolfgang Linnenberger)
|
|
Unmittelbar
nach dem Tag X begann auch an der Saar die
Elektrifizierung, und zwar mit den
Strecken Homburg-Saarbrücken,
Saarbrücken-Forbach und
Saarbrücken-Fürstenhausen-Überherrn. Der
Betrieb unter Fahrdraht startete bereits
am 8. März 1960 nach Forbach und Homburg
und am 30. Mai 1960 nach Überherrn. Die
Hauptstrecke Völklingen-Saarhölzbach
schloss 1972 die Elektrifizierung im
Saarland vorläufig ab.
Anfang
der 70er-Jahre wies die Bundesbahn-
Direktion Saarbrücken einen Bestand von
rund 500 Triebfahrzeugen aus; davon waren
immerhin noch 100 Dampflokomotiven. Am 11.
Juni 1976 wurde die letzte Dampflok im
Direktionsbereich abgestellt; es war eine
Güterzuglokomotive der Baureihe 50.
Im Zuge der 1992
begonnenen Bahnreform wurde die
Bundesbahndirektion Saarbrücken Ende
1993 aufgelöst.
|
Eine Dampflok der Baureihe 42 zieht 1959
einen leeren Erzzug von Burbach nach
Überherrn. Die Fahrleitungen für den
elektrischen Betrieb sind bereits
montiert.
Foto:
Sammlung Kurt Harrer
(in seinem Buch: Eisenbahnen
an der Saar, S. 106)
|
|
Aus
der staatlichen DB wurde die
privatrechtliche DB AG. Diese war jetzt in
vier Geschäftsbereiche für
Personenverkehr, Güterverkehr, Traktion
und Werke (zuständig für die
Schienenfahrzeuge) sowie Netz (zuständig
für die Infrastruktur) organisiert. Die
ehemals regionale Orientierung war nun von
untergeordneter Bedeutung.
Seit
der zweiten Stufe der Bahnreform von
1999 ist die DB AG eine
Holding
mit fünf eigenständigen
Tochterunternehmen.
|
|
_____________________
Verwendete
und empfohlene Literatur
zu
dieser Seite:
-
Kurt Harrer:
Eisenbahnen an der Saar
- Eineinhalb
Jahrhunderte Eisenbahngeschichte zwischen
Technik und Politik. Düsseldorf, 1984.
(Wir
sind dem leider Anfang 2014 verstorben
Autor dieses Buches zu großem Dank
verpflichtet für seine kompetente und
großzügige
Unterstützung
beim Thema Eisenbahnen im Saarland.)
-
Eisenbahn-Kurier Special 86: Die
Eisenbahn im Saarland, EK Verlag
Freiburg, 3. Quartal 2007
-
Kandler, Udo. Faustpfand (saarländische
Eisenbahn-Historie)
in:
Eisenbahn Journal,
April 2007 Seite 12 - 25
|
|
|
Die
Dienstsiegel
der
saarländischen
Eisenbahnen in
den
verschiedenen
Zeitabschnitten
Quelle:
Gedenkblatt
130 Jahre EbD
Saarbrücken
aus 1982
|

|
|
F)
Lokomotiven
und Triebwagen in der Saarstaatzeit
In diesem
Abschnitt stellen wir Maschinen aus dem Bestand der
SEB, der EdS und der Bundesbahn-Direktion
Saarbrücken vor.
Aufgrund
der
Ersatzteilsituation mussten Lokomotiven im
Nachkriegssaarland einige Modifikationen über sich
ergehen lassen. So wurden z.B. nur noch Achslager nach
französischem Standard eingesetzt. Da das
Kesselspeisewasser bei der EdS chemisch nach SNCF-Norm
aufbereitet wurde, mussten gesonderte Trinkwassertanks
und Handwaschbecken für das Lokpersonal eingebaut
werden. Der Einsatz als Vorspann mit schweren
Kohlenzügen im Fischbach- und Sulzbachtal, oft sogar
mit zusätzlicher Nachschiebelok, förderte den
Verschleiß.
|
Lokomotiven
der Baureihe 38 fanden im
Personenverkehr meist vor D-Zügen
Verwendung. Die ersten Loks waren bereits
1906 als preußische Baureihe P8 abgeliefert
worden. Auffällig ist bei dieser Lok der
größere Achsabstand zwischen der hinteren
und der mittleren Kuppelachse. Bis 1923
waren über 3900 Maschinen gebaut worden.
Einige davon blieben mehr als 50 Jahre in
Betrieb. Die meisten saarländischen 38er
waren im Betriebswerk Saarbrücken Hbf
beheimatet.
Die
Höchstgeschwindigkeit betrug zwar vorwärts
100 km/h, rückwärts jedoch lediglich 69
km/h. Rückwärtsfahrt wurde wegen unruhigen
Laufverhaltens möglichst vermieden. Die hohe
Achslast der Lok ließ den Betrieb auf
Nebenstrecken nicht zu. Vor schweren
Schnellzügen oder Güterzügen konnte der
Loktyp wegenseiner begrenzten Zugkraft nicht
eingesetzt werden.
Foto
rechts: Die 383132 vor einem
Abteilwagenzug im Saarbrücker Hbf.
Foto: Walter
Barbian
Eine
weitere 38er ist ganz oben auf dieser
Seite zu sehen.
|

|
|
Die
Loks der Baureihe 42 wurden von 1943
bis 1949 in verschiedenen Werken (z.B.
Berlin, Wien, Esslingen) produziert.
Ursprünglich war der Bau von 8.000 Stück
geplant, wenig später wurde die Planung auf
5.000 Exemplare zurückgeschraubt. Es wurden
aber einschließlich der Nachbauten insgesamt
nur 1.063 Stück hergestellt. Diese Loks waren für schwere
Güterzüge vorgesehen. Die Deutsche
Reichsbahn schaffte die Baureihe 42 als
Kriegs-Dampflokomotive KDL 2
an. Nach dem Kriegsende wurden viele halb
fertig in den Lokomotivfabriken stehende
Maschinen komplettiert und überwiegend an
Frankreich und Belgien abgeliefert.
Nachbauten erfolgten in Österreich und
Polen. In der Bundesrepublik wurden die Loks
bis 1956 ausgemustert, weil Kessel und
Fahrwerk gegen Schäden anfällig waren (bei
Cochem war z.B. 1951 ein Kessel explodiert).
Die Eisenbahnen des Saarlandes betrieben 21
Lokomotiven der Baureihe 42.
|
|

|
Diese
wurden nach dem Anschluss des Landes an die
Bundesrepublik am 1. Januar 1957 von der
Deutschen Bundesbahn übernommen. Sie setzte sie aber nur im
Raum Saarbrücken für Erztransporte und im
Verschiebedienst ein. Die letzte Lok dieses Typs wurde am
10. Oktober 1962 ausgemustert. Andere
europäische Länder betrieben die Loks aber
weiter, und in Polen sollen noch im Jahr 2010 eine
oder zwei von ihnen in Betrieb gewesen sein.
Foto:
Die
SAAR 42 2356 konnte man 1952 anlässlich
der Ausstellung "Aus 100 Jahren Post und
Eisenbahn" am Bahnhof Bexbach
besichtigen. >
mehr zu dieser Ausstellung
|
Baureihe
50: Ein Glücksgriff für die
saarländische Eisenbahn-Verwaltung waren die
80 im Saarland verbliebenen Güterzuglokomotiven dieser Baureihe,
welche die Reichsbahn ab 1939
beschafft hatte. Sie waren auf die Anforderungen des zu
erwartenden Kriegseinsatzes hin ausgelegt
worden und bildeten das stabile Rückgrat des
Güterzugverkehrs. Insgesamt wurden 3.146 Maschinen
dieser Baureihe gebaut.
Mit
einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h
sowohl in Vorwärts- als auch in
Rückwärtsfahrt und mit eingebauter Dampfversorgung
für die Heizung von Personenwagen
waren sie als Universallokomotive geeignet.
Dank ihrer maximalen Achslast von nur 15 Mp
konnten sie auch Nebenstrecken befahren.
Überwiegend setzten die saarländischen
Eisenbahnen Loks dieser Baureihe
vor Kohlen- und Erzzügen ein. Sie waren
Stammloks auf den Verbindungen nach
Thionville und deshalb hauptsächlich in den
Betriebswerken (Bw) Neunkirchen,
Saarbrücken, Völklingen und Dillingen
beheimatet. Farbbild oben links: Die 050 607-1 1975 im
Saarbrücker Hauptbahnhof
Foto oben links:
www.dampfsound.de
oben rechts: Sammlung W.
Linnenberger
|
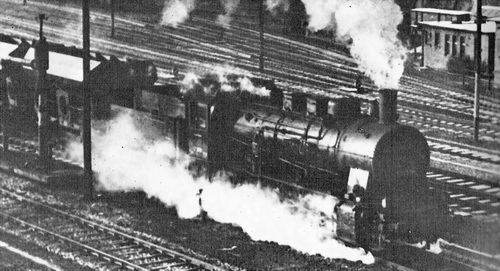
|
Die
Güterzuglokomotive der Baureihe 57
wurde als preußische G10 von Henschel in
Kassel entwickelt. Zwischen 1910 und 1924
verließen rund 3000 Maschinen die Fabriken.
27 Nachbauten gingen in den 20er-Jahren an
die Saar-Bahn. Die Baureihe 57 war
ursprünglich für kurvenarme Bahnstrecken
vorgesehen. Sie galt als wartungs- intensiv
und anfällig. Von den vorhandenen 81
Lokomotiven der EdS konnte daher 1954 nur
etwa die Hälfte eingesetzt werden. 63
Maschinen gingen an die DB über, jedoch nur
37 davon waren noch betriebsfähig. Bis Ende
der 60er-Jahre stellte die Bundesbahn
sämtliche Lokomotiven der Baureihe ab.
Bild:
Die 57 2575 rangiert im Verschiebebahnhof
Saarbrücken (1959).
Foto: Kurt Harrer-Buch S. 116
|
|
Die
Baureihe 78
umfasste Personenzug-Tender-
Lokomotiven,
die ab 1912 als
T
18 gebaut wurden. 45 Maschinen wurden
bereits in der Völkerbundzeit an die
"Saarbahnen" geliefert. Nach diversen
technischen Verbesserungen konnten die
robusten Lokomotiven für eine
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h
zugelassen werden. Mit ihrer Leistung von
1140 PS und der maximalen Achslast von 17
Mp waren sie auch für den Betrieb auf
Nebenstrecken geeignet. Gerne setzte man
sie von Völklingen aus auf der
Köllertalbahn ein.
Nach dem Krieg
fuhren 424 Maschinen der BR 78 in den
westlichen Besatzungszonen und 32 im
Saarland. Letztere wurden 1957 alle von
der DB übernommen, verblieben aber bei der
BD Saarbrücken. Deren Gesamt-Bestand an
78ern schrumpfte bis 1968 auf nur noch 50
Exemplare. Alle Loks der Baureihe wurden
bis
1974 abgestellt.
Rechts:
Eine Lok der BR 78 in Völklingen. (Sammlung
Schöpp)
|
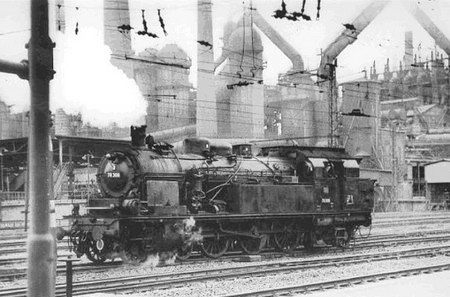
|
|

|
Rangierlokomotiven
Für
ihren ausgedehnten Rangierdienst beschaffte
die EdS 1956 zehn Rangierloks. Sie erhielten
die Bezeichnung V
45. Die Entscheidung für diese
Lokomotiven war noch wesentlich von der SNCF
beeinflusst, die 20 baugleiche Maschinen bei
SACM (Société Alsacienne de Constructions
Mécaniques in Graffenstaden) bestellt hatte.
Die
Zwölfzylinder-Dieselmotoren der V 45 mit 400
PS, Typ SBD, stammten von Saurer, das
hydraulische Getriebe lieferte Voith, das
Nachschaltgetriebe SACM. Neben einem
Rangier-
Gang stand ein Strecken-Gang zur
Verfügung, der 50 km/h Höchstgeschwindigkeit
erlaubte. Die beiden Radsätze wurden per
Kette angetrieben. Nach dem Tag X setzte die
Deutsche Bundesbahn im Saarland Rangierlokomotiven
ihrer in großen Stückzahlen beschafften
Baureihe V 60 ein. Der Versuch, die
vorhandenen V 45-Lokomotiven zu
verkaufen, war erfolglos.
|
|
Da es
auch nicht gelang, ihr auffällig lautes
Betriebsgeräusch zu dämpfen, wurden acht
Maschinen zum Dienst in verschiedenen
Ausbesserungswerken nach Nordrhein-Westfalen
abgegeben. Zwei wurden zu
"Ersatzteilspendern" erklärt. Erst Ende 1980
waren alle ausgemustert. Foto
oben: Kurt Harrer-Buch, Seite 96
Der
Zeitzeuge Jean Kind erinnert sich an eine
gelbe Diesel-Rangierlokomotive, die im
Saarbrücker Ostviertel im Einsatz war. Es
könnte eine ehemalige Wehrmachtslokomotive
WR 200 B14 gewesen sein, die zivil als V
20 bezeichnet wurde. Da bei SEB und EdS
keine Rangierloks mit Dieselmotor gelistet
waren, muss es sich um eine Werkslok
gehandelt haben. Auch ihr gelber Anstrich
legt diese Vermutung nahe.
|
Schienenomnibusse
|
Für
den Personenverkehr mit geringen
Fahrgastzahlen auf Nebenstrecken war der
Betrieb mit Dampflokomotiven
unwirtschaftlich. Zur Verbesserung der
Situation orientierten sich die
Bahnverwaltungen am Omnibus. Im August
1950 lieferte die Waggonfabrik
Uerdingen elf Schienenfahrzeuge aus, die
nach den Prinzipien des Omnibusbaus
konstruiert worden waren. Sie erhielten die
Bezeichnung VT 95. Die
Höchstgeschwindigkeit der
„Schienenomnibusse“ betrug 90 km/h. Passend
dazu gab es einen Beiwagen VB 142,
der mit einer Scharfenberg-Mittelkupplung
angehängt werden konnte.
Die Lehnen der mit
Kunstleder gepolsterten Sitzbänke für 60
Fahrgäste konnten beim Wechsel der Fahrtrichtung
einfach umgeklappt werden. Heute im
Personennahverkehr fast ein Luxus, aber damals
offenbar noch unverzichtbar: In allen
Fahrzeugen war eine Toilette mit
Wasserspülung eingebaut.
Foto: Sammlung Kurt
Harrer (Buch S.108)
|
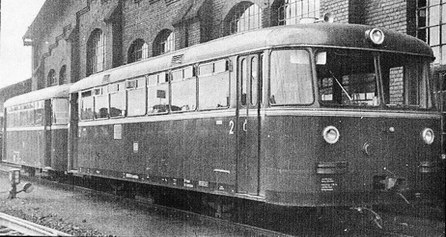
|
Die
Uerdinger Schienenbusse erschienen der EdS als gut
geeignet für den Einsatz auf ihren Nebenstrecken.
Sie hätten allerdings importiert und
verzollt werden müssen. Man fand schließlich eine
kostengünstigere Lösung. Die Waggonfabrik Gebr.
Lüttgens in Saarbrücken durfte 15 Garnituren,
bestehend aus Motor- und Beiwagen, in Lizenz bauen.
Statt Büssing- erhielten sie Berliet-Motoren. Den in
Burbach gebauten Fahrzeugen fehlte an den Stirnseiten
das Markenkennzeichen des Originals, die
“Uerdingen-Raute“. Am Ende wurden insgesamt 15
Schienenbusse und 12 Beiwagen abgeliefert. Eine solche
Garnitur zeigt das Bild oben.
Die bei
Lüttgens gefertigten Fahrzeuge erhielten ab etwa 1962
nach und nach die bei der DB üblichen Büssing U
10-Unterflur-Motoren mit 150 PS. Sie blieben bis zu
ihrer Ausmusterung in den 70er-Jahren in Saarbrücken
Hbf beheimatet. Erst
1983 quittierte der letzte VT 95 der DB seinen
Dienst.
Planmäßig
in Saarbrücken: Autorail X 3800 der SNCF
Exoten im
Saarbrücker Hauptbahnhof waren Schienenbusse
vom Typ X 3800 der SNCF. In Frankreich nannte
man sie “Picasso“ wegen ihres asymmetrischen
Dachaufbaus, in dem der Fahrer Platz fand (siehe
Foto). Sie bedienten im Nahverkehr zeitweise ab
Saarbrücken die Strecke nach Falck-Hargarten über
Béning und Carling. Die Abfahrt erfolgte meist auf dem
einen der beiden westlichen Stumpfgleise des
Saarbrücker Hauptbahnhofs; auf dem anderen begannen
regelmäßig die kurzen, dampfbespannten Personenzüge
ihre Fahrt nach Großrosseln. Die EdS fuhren ebenfalls
Züge nach Hargarten-Falck (so die deutsche Bezeichnung
des Zielbahnhofs), über Fürstenhausen, Hostenbach und
Überherrn. In Lothringen wurden die Bergleute von den
“Picassos“ bei Schichtwechsel auch von Béning über
Freyming-Merlebach zu der Grube “Wendel“ in
Petite-Rosselle (Kleinrosseln) und zurück
transportiert.

Die Baureihe X
3800 war von der SNCF in Zusammenarbeit mit Renault
entwickelt worden. Ziel war ein möglichst
kostengünstiges Schienenfahrzeug. Daher wurden, was
den Antrieb angeht, konsequent die Prinzipien des
LKW-Baus verfolgt. Die Fahrzeuge hatten eine
mechanische Handschaltung mit vier Gängen und
zusätzlichem Wendegetriebe für Rückwärtsfahrt.
Eingebaut wurde ein zwölfzylindriger Dieselmotor mit
300 PS, später sogar 360 PS. Er verfügte über 600 CV
(Steuer-PS). Außer Motoren von Renault kamen auch
solche von Saurer zum Einsatz. Die Kupplung hatte eine
mechanische Fußbetätigung und war aufgrund des starken
Dieselmotors und der damit notwendigen hohen
Betätigungskraft mit Druckluft unterstützt. Sonstige
Hilfen gab es nicht.
Der
Triebfahrzeugführer fuhr stehend.
Auf freier Strecke konnte er zeitweise jedoch
auch sitzen, und zwar quer zur Fahrtrichtung. Der
riesige V-Motor füllte raumhoch den Platz unter dem
Führerstand aus. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 120
km/h. Mit zwei Beiwagen und einem weiteren Motorwagen
ließen sich Züge zusammenstellen, die mehr als 300
Reisende befördern konnten.
Ein Teil der
bis 1961 ausgelieferten 251 Fahrzeuge wurde bei
DeDietrich in Reichshoffen gebaut. Sie wurden bis Ende der
80er-Jahre auf Nebenstrecken und bei Privatbahnen
eingesetzt.
In heutiger
Zeit ist im Musée de la Mine (Grubenmuseum) in
Kleinrosseln ein Exemplar des X 3800 zu besichtigen,
und auf Youtube kann man unter dem Stichwort X 3800
Videos mit Picassos finden. Foto
oben: Ivonne
Pitzius
____________________________
Verwendete
Literatur (Abschnitt
F):
Estler, Thomas.
Das große Loktypenbuch (Transpress
Spezial). Transpress, Stuttgart. 2004, Seite 60
Obermayer,
Horst J. Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven.
Franckh´sche Verlagsanstalt Stuttgart. Siebte
Auflage 1979, Seite 98
Kurt Harrer:
Eisenbahnen an der Saar - Eineinhalb Jahrhunderte
Eisenbahngeschichte zwischen Technik und Politik.
Düsseldorf, 1984
Persönliche Erinnerungen
unserer Leser an Loks der SEB finden Sie am Ende
dieser Seite im Abschnitt
L.
|
|
G)
Besondere Waggons der Saarländischen Eisenbahnen
a)
Salonwagen
Salonwagen
waren seit den Anfangszeiten der Eisenbahn ein
Privileg der Regierenden und der Eisenbahnpräsidenten.
Im Dritten Reich wurden sie in Sonderzügen mitgeführt
und dienten während des Krieges als rollende
Hauptquartiere der Heeresleitung. Sie basierten auf mehrachsigen Reisezugwagen,
die entsprechend den Anforderungen der späteren
"hochrangigen" Benutzer aufgeteilt und ausgestattet
wurden. Als Salonwagen bezeichnete man z.B. besonders
komfortabel eingerichtete Abteilwagen mit Seitengang,
aber auch Schlaf- oder Speisewagen. Eine häufige
Variante waren Wagen, die an einem Ende keine Abteile
und keinen Seitengang hatten, sondern einen großen
Raum, der über die gesamte Wagenbreite reichte. Das
war der "Salon".
|
|
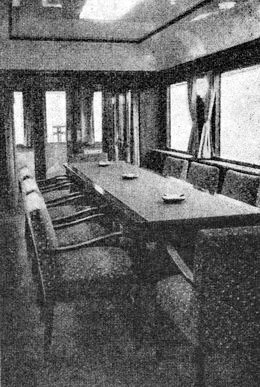
|
Es ist nicht
verwunderlich, dass die Besatzungs- mächte nach dem
Krieg die noch vorhandenen Salonwagen beschlagnahmten.
Den
Franzosen
gelang es allerdings nicht, selbst einen Salonwagen
der Reichsbahn zu requirieren; sie mussten sich mit
dem von den Amerikanern überlassenen Wagen Nummer
10252 begnügen. General Pierre Koenig benutzte ihn
bis 1952. Zusätzlich wurde aus Frankreich der
Salonwagen Nr. 53 der SNCF herbeigeholt. Er kehrte
erst 1959 wieder dorthin zurück.
Eine
Alternative zum klassischen Salonwagen, der ja immer
eine Lokomotive benötigte, stellten umgebaute
Triebwagen dar. Mehrere
reichs- deutsche Nahverkehrs-Triebwagen der Baureihe
137 waren in der französischen Zone verblieben und
wurden in Landau beheimatet.
Zwei von ihnen,
die später die DB Nummern 33 222 und 33 232 erhielten,
wurden zu Salontrieb- wagen für die französische
Militärregierung umgebaut.
|
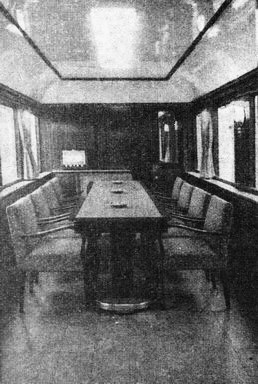
|
|
Die beiden
Bilder zeigen die Inneneinrichtung des
EdS-Salonwagens. (Fotos aus E. Zimmer. Die Saarbrücker Eisenbahnverwaltung
im Wandel der Zeit. 1959)
|
|
Ein
weiterer, der als VT 137137 von der
Waggonfabrik Dessau gebaut worden war und im
Reichsbahn-Ausbesserungswerk Friedrichshafen
den Krieg überlebt hatte, tauchte ab 1947 in
Saarbrücken auf. Mit einem MAN-Motor und
mechanischer Kraftübertragung per
Viergang-Getriebe erreichte er eine
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
Im
Jahr 1952 wurde
seine Inneneinrichtung ausgebaut und zur
Ausgestaltung eines Salonwagens der EdS
benutzt. Als Basis diente ein
Drehgestell-Eilzugwagen der Bauart 4Ci mit
Doppeltüren. Der Salon war als
Konferenzraum eingerichtet. Zusätzlich
baute man eine Küche ein. Die EdS nannte
ihn Salonwagen Nr.1. Die
bahnamtliche Bezeichnung war zunächst SAAR
WG4ü1 und später bei der DB 10216.
Der
Triebwagen VT 137137, der seine
Inneneinrichtung für diesen Salonwagen Nr.1
gespendet hatte, wurde am 4.12.1957
ausgemustert. 1958 erfolgte sein Umbau im
Ausbesserungswerk Saarbrücken-Burbach zu
einem Schulungswagen (Lehrstellwerks-Wagen).
Die Antriebsausrüstung wurde entfernt. So
blieb er erhalten und befindet sich heute im
Nahverkehrsmuseum Aumühle bei Hamburg.
b) Gesellschaftswagen
Die
fünfziger Jahre waren das Jahrzehnt der
Bahntouristik. Die Bahn bot Tagesfahrten mit
Sonderzügen zu beliebten Ausflugszielen an
wie etwa zu den Weinorten an Ahr, Rhein,
Mosel und in der Pfalz.
|
|
Diese
Züge bestanden meist aus Eilzugwagen mit
Mittelgang. Die Fahrt in solchen
Großraumwagen sollte offenbar die
Kommunikation und das gemeinsame Singen
unter den Fahrgästen fördern. Als besondere
Attraktion wurde oft ein Gesellschaftswagen
mitgeführt.
Die
EdS hatte dazu im Ausbesserungswerk Burbach
einen ehemaligen vierachsigen Gepäckwagen
umbauen lassen. Seine ursprüngliche
Bestimmung war ihm anzusehen, hatte er doch
weiterhin seine windschnittige Dacherhöhung,
auch Schildkröte genannt, über dem
ehemaligen Zugführerabteil behalten.
|
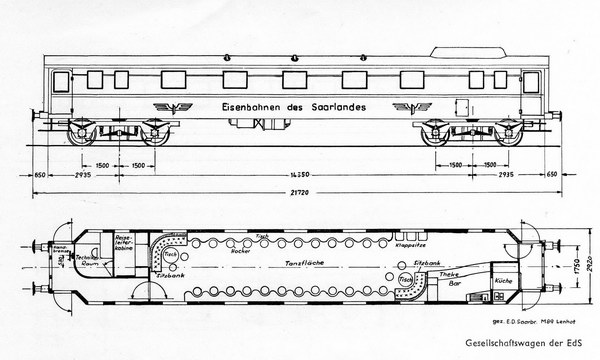
|
|
Zentrales
Element der Inneneinrichtung war eine große
Tanzfläche, weshalb der Wagen im Volksmund
„Sambawagen“ genannt wurde. An die
Tanzfläche schloss sich eine Bar-Theke an.
|
|
Weiter
gab es einen Wirtschaftsraum, ein
Reiseleiter- Abteil und ein Technik-Abteil
mit einer „Beschallungs- anlage“. Dort
durfte ein dafür mehr oder weniger begabter
Bahnbeamter Schallplatten abspielen. Da er
keinen Sichtkontakt zur Tanzfläche hatte,
die Disco war noch nicht erfunden, kam in
der Regel erst Stimmung während der
Rückfahrt auf. Voraussetzung war ein noch
genügend großer Getränkevorrat. Es kam
durchaus vor, dass der Wagen auf der
Rückreise schnell „ausgetrocknet“ war.
Als
besondere Attraktion hingen,nicht
ausnahmslos zur Freude der Mitreisenden, in
den anderen Wagen des Sonderzuges ebenfalls
Lautsprecher. Das übertragene Musikprogramm
und der Klang waren, auch für damalige
Verhältnisse, bisweilen grausam.
Manche Schulen führten sogar ihre Wandertage
per Sonderzugfahrt durch. Skizzen u. Foto: EdS-Jahresbericht
1952
|
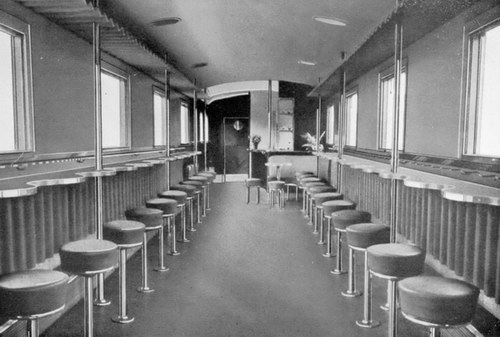
|
Daten
zum VT 137137 aus: Horst J. Obermayer:
Taschenbuch Deutsche Triebwagen,
4.Auflage 1979, Franckh´sche
Verlagshandlg. Stuttgart, S.175
|
|
|
H)
Bahnhöfe im Saarland
|
Der
Saarbrücker Hauptbahnhof...
...
wurde am 16. November 1852 als "Bahnhof St.
Johann-Saarbrücken" an der Banngrenze
zwischen Malstatt und St. Johann eröffnet.
Er wurde von der St. Johanner Bahn bedient,
die von Bexbach über Neunkirchen kommend
weiter nach Stieringen zur französischen
Ostbahn führte.
Der
Sandsteinbau lag als so genannter "Inselbau"
zwischen den beiden Gleisen; der Zugang
erfolgte – für damalige Verhältnisse
neuartig – durch eine Unterführung, also
ohne Gleisüberquerung. Der ursprüngliche,
dreigeschossige Inselbau war auf einem hohen
Bahndamm in festungsartiger Bauform mit vier
Ecktürmen errichtet worden. Er hatte einen
erhöhten Mittelpavillon, der auf der
Eingangsseite des Bahnhofs von zwei
viergeschossigen Türmen flankiert wurde.
|
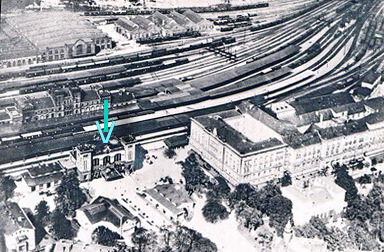
|
|
Mit
dem
fortlaufenden Wachsen der Bahnanlagen
wurde das Bahnhofsgebäude durch Anbauten
in den Jahren 1866 und 1879 erweitert.
Bereits im Jahr 1872 hatte man vor dem
hohen Bahndamm ein eingeschossiges
Empfangsgebäude errichtet, das in den
Jahren 1891/1893 durch ein Vorgebäude mit
zwei markanten Türmen vor dem Tunnelzugang
ersetzt wurde. Schon 1908 gab es Pläne,
ein völlig neues Bahnhofsgebäude zu
errichten. Mit dem Bau sollte im Jahr 1914
begonnen werden; der Ausbruch des Ersten
Weltkrieges verhinderte dies.
|
Nach
der
Rückgliederung des Saargebiets
1935 ins Deutsche Reich plante man wiederum einen
Bahnhofsneubau, der 1941
abgeschlossen sein sollte. Die
Ausführung dieses Vorhabens wurde
aber durch den Kriegsausbruch 1939
vereitelt.
Am
Ende
des Zweiten Weltkriegs waren 80
Prozent der Bahnanlagen zerstört.
Von dem Eingangsgebäude der Jahre
1891/1893 standen nur noch die
beiden Türme. Auch die übrigen
Hochbauten, wie etwa das
Bahnbetriebswerk, waren stark
zerstört. Der Westtrakt des
Inselgebäudes mit dem angrenzenden
Wartesaal und der Mittelbau waren
ebenfalls sehr in Mitleidenschaft
gezogen.
An
den
Seiten und zwischen den beiden
Türmen des Vorgebäudes wurden im
Jahr 1952 Flachbauten errichtet,
die dann für viele Jahre ein
unschönes Provisorium darstellten.
Die Überhöhung an dem
Mittelpavillon des Inselgebäudes
wurde abgetragen und ein Dach über
die ganze Länge des Gebäudes in
gleicher Höhe gezogen
(siehe
Bild rechts
- Foto: R.
Schedler).
|

|
|
|

|

|
|
Saarbrücker Hauptbahnhof in
den 50er-Jahren,
um
die Mittagszeit
(Foto:
Günther Faust)
|
Oben: Blick
auf Gleis 1
(Foto aus dem Jahresbericht der
EdS von 1954)
|
|
Morgens
und
abends waren sehr viele Menschen zum und vom
Bahnhof unterwegs. Um die Fußgänger vor dem
hohen Fahrzeugverkehr zu schützen,
errichtete man über der Reichsstraße kurz
vor dem Bahnhofsvorplatz ein hölzernes Behelfsbrückenbauwerk.
(Bild
rechts: Blick vom Bahnhof aus)

Foto:
Saarländische Wochenschau, 1954
|
.

Foto:
W. Barbian: http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu
|
|
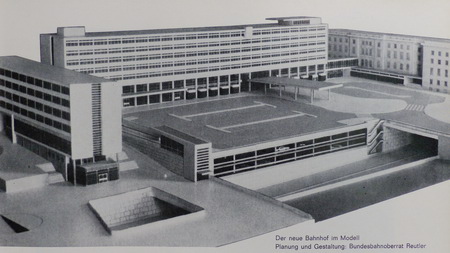
|
In
den frühen 1960er-Jahren wurden neue Pläne
für den Bau eines Empfangs- und
Verwaltungsgebäudes erstellt. Planung und
Gestaltung lagen in Händen von
Bundes-bahnoberrat Reutler.
Der
erste Spatenstich erfolgte am 27. Juni 1963.
Im selben Jahr wurden die Reste des alten
Vorgebäudes von 1891/1893 entfernt.
Ende
September 1967 konnte man schließlich das
neue Bauwerk einweihen.
Das
Foto zeigt den neuen Bahnhof, so wie er im
Modell geplant war.
|
|
Die
nachfolgenden Bahnhöfe sind (ab Bahnhof
Beckingen) in alphabetischer
Reihenfolge der Städte und Gemeinden aufgeführt.
|
Bild
unten:
1952
auf dem Saarbrücker Bahnhofsvorplatz, mit
Blick zur
Trierer Straße mit vielen Ruinen. (Foto: Helmut
Schmidt, Niederlinxweiler)
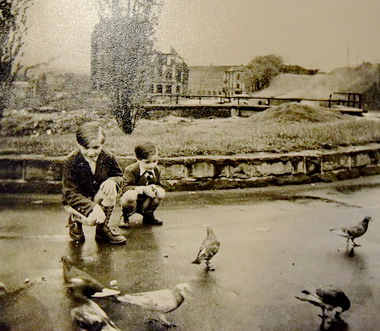
|
Bahnhof
Beckingen
1860
erbaut und in Betrieb genommen, wurde er am
Ende des Zweiten Weltkriegs schwer
beschädigt und sein Turm total zerstört. Von
2009 bis 2013 ist er renoviert worden. (Foto:Gemeinde
Beckingen)

|
|
Bahnhof
Bexbach
|
|
|

Bahnhof
Bexbach
(etwa 1960)
(Foto:
MAN-Werksfoto)
|
 Derselbe
Bahnhof im Jahr 2009 (Fotos oben und unten: R. Freyer) Derselbe
Bahnhof im Jahr 2009 (Fotos oben und unten: R. Freyer)
|
|
Der
Bexbacher Bahnhof ist der älteste Bahnhof im
Bereich des heutigen Saarlandes. Er wurde
von 1848 bis 1849 als Grenzbahnhof zwischen
Bayern und der preußischen Rheinprovinz
erbaut, und er wechselte wie
die Gemeinde, zu der er gehörte, mehrmals
seinen Namen.
Zunächst hieß er
"Bahnhof Bexbach", von 1937 bis kurz nach
dem Krieg "Bahnhof Höcherberg" und seit dem
1. Januar 1947 wieder "Bexbach".
Mehr über den
Bexbacher Bahnhof sehen Sie auf unserer
Seite
Post- und
Eisenbahn-Ausstellung Bexbach 1952!
|

|
|

|
Bahnhof
Brotdorf
Dieser Bahnhof wurde von der
Merzig-Büschfelder Eisenbahn bedient.
Diese
Kleinbahn war keine Staatsbahn, sondern
gehörte zu gleichen Teilen dem preußischen
Staat, dem Provinzialverband der
Rheinprovinz und dem Kreis Merzig.
Mehr
dazu finden Sie auf unserer Seite über die private
Merzig-Büschfelder
Eisenbahn.
Bahnhof Dudweiler
(Fotos:
Dudweiler
Geschichtswerkstatt)
|
|

|
Auf
dem Bild links (von etwa 1955) sind die
starken Grubenschäden der damaligen Zeit gut
zu erkennen.
Das
Foto von den Bahnsteigen ↓ ist aus den
60er-Jahren.

|
|

|
Rechtes
Foto:
So
sieht der Dudweiler Bahnhof heute aus.
(Foto:
Reiner Schwarz, Juli 2019)
Das
Bild links ist eine
Ausschnitts-Vergrößerung aus dem Foto
darüber.
Vielen
Dank an Reiner Schwarz für die
Übermittlung der S/W-Bilder!
|

|
|
Bahnhof
Einöd: Schulausflug Juli 1959:
Hermann
Hesse, Rainer Freyer und Gerd Rohrbach (alle
damals etwa 17 Jahre alt)
Foto:
Hubert Uertz (vorne links - sein
Selbstauslöser lief schneller als er!)

|
Bahnhof
Gersweiler
(Vorkriegsaufnahme)
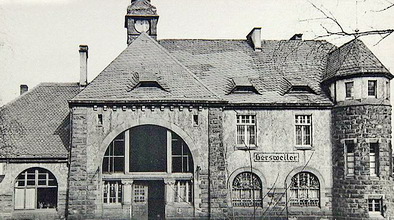
|
|
Bahnhof
Homburg vor dem Krieg
>>
Der
Bahnhof der Stadt Homburg wurde
schon 1846 errichtet. Er sah viele
Jahrzehnte lang so aus wie auf diesem
Bild. Nach dem Zweiten
Weltkrieg ist er durch einen Neubau
ersetzt worden.
Die beiden Bilder unten zeigen den
Neunkircher Hauptbahnhof
vor
dem Zweiten Weltkrieg (Bild links) und kurz
danach (Bild rechts)
|

|
|

|
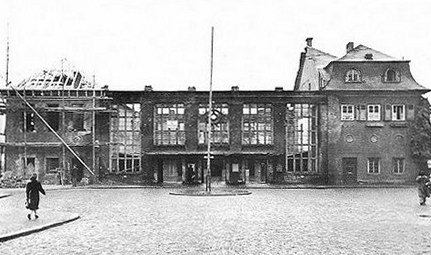
|
|
Der
Neunkircher Bahnhof wurde schon zu Beginn
der 1850er Jahre als zweiter Bahnhof
in unserem Land
erbaut (nach dem Saarbrücker Bhf.).
Das
Bild links ist von etwa 1930, das
rechte Foto zeigt den Bahnhof kurz
nach dem Krieg im Jahr 1945. (Fotos:
Sammlung Hansjürgen Wenzel)
|
|
|
Bahnhof
Lebach

|
|
Bahnhof
Püttlingen in
den 50ern
|
|

Foto
oben von: https://www.saarland.de/103901.htm
|
|
|
Bahnhof
Völklingen (Foto
unten von:
http://de.nailizakon.com)
|
|
|
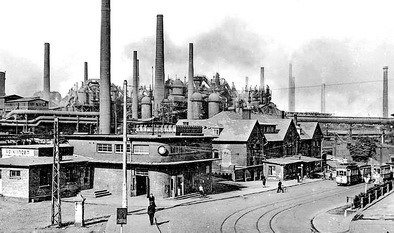
|
|
|
Bahnhof
Wemmetsweiler

|
|
|
|
|
I)
Eisenbahner-Uniformen,
Rangabzeichen und Mützen
Soweit uns
bisher bekannt, gab es in der Zeit nach dem Krieg bis
1955 keine eigenen Uniformen für die Eisenbahner im
Saarland. Wahrscheinlich trugen sie einfache
Dienstanzüge in dem Schnitt, wie er bis 1945 allgemein
bei der Reichsbahn üblich war, jedoch ohne
irgendwelche Rangabzeichen. Erst am 12. Juli 1955
legte die Regierung des Saarlandes Rahmenvorschriften
für die Eisenbahneruniformen fest [1]. Sie galten vom
6. Oktober 1955 bis Ende 1956. Nach der Eingliederung
in die Bundesrepublik richtete man sich nach den
Dienstkleidungsvorschriften der Deutschen Bundesbahn.
[1]
veröffentlicht im Sonder-Amtsblatt der Eisenbahnen des
Saarlandes vom 6.10.1955. Interessierte Leser
finden hier
dieses Amtsblatt mit allen Einzelheiten
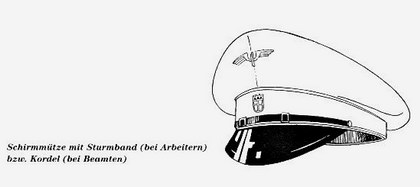
An den Schirmmützen
befanden sich ein stilisiertes Flügelrad als
Eisenbahn-
Abzeichen und das Saarlandwappen in
kleiner Form. Das Mützenband und der obere Rand der Mützen
waren rot umrandet.
|
|

Das Bild zeigt
den Fahrdienstleiter Alois Giehr,
wie er auf dem
Bahnhof Heusweiler das Abfahrt-
signal für den
Zug der Köllertalbahn gibt.
Foto: Alois
Giehr, Heimatkundlicher Verein Köllertal e.V.
|
|

|
Rangabzeichen
Die Dienstgrade
der Eisenbahner waren bis zum 5. Oktober 1955 nur an
den Farben der SEB-Aufnäher
zu erkennen (Bild
links); nach diesem Datum an den
Kragenspiegeln:
|
|
Kragenspiegel
der Eisenbahnen des Saarlandes (EdS)
Kragenspiegel
sind Dienstgradabzeichen an den Kragenenden der
Uniformjacken. Am Kragen des Eisenbahners auf dem Foto
oben rechts kann man sie gut erkennen. Die Dienstgrade
wurden bei den Beamten des einfachen und mittleren
Dienstes durch viereckige Sterne und bei Beamten des
gehobenen Dienstes durch dreieckige Sterne an den
Kragenspiegeln der Jacke (aber nicht des Mantels)
unterscheiden. Die Arbeiter trugen keine
Rangabzeichen.
Die oben
abgebildeten SEB-Aufnäher und die Kragenspiegel
unten befinden sich im Besitz eines privaten
Sammlers. Sie dürften in dieser Form die
vollständigste "Sammlung weltweit“ darstellen.
|
|
|


|
Farbfotos
oben: Frank Steinmeyer, Leipzig
|
J) Verschiedene
Eisenbahn-Dokumente
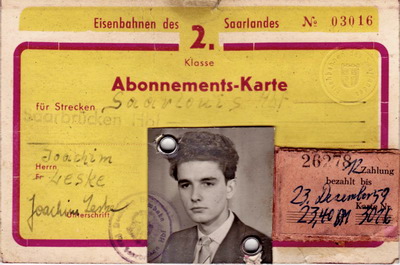 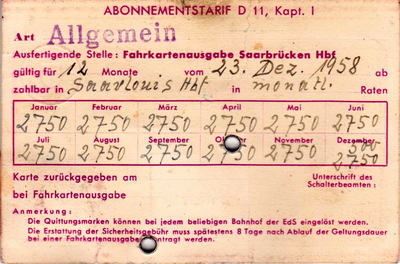
Vorder-
und Rückseite einer Abonnements-Karte für die Strecke
Saarlouis-Saarbrücken aus dem Jahr 1958. Auf der Rückseite (Bild rechts)
lauten
die Preise noch auf Franken (z.B. 2750), auf der
Vorderseite (Bild links) aber schon in DM. (Danke an Andreas Rival,
Roden, für die Abbildung)
|
|
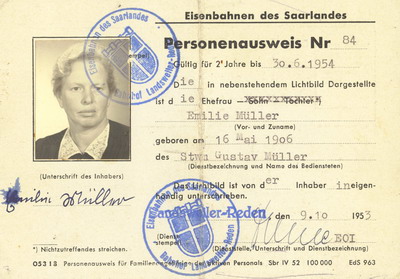 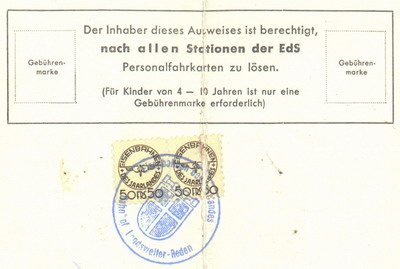
Mit einem
solchen "Personenausweis" konnte auch die Ehefrau
eines Bediensteten der EdS verbilligte
Personalfahrkarten
für Reisen
innerhalb des Saarlandes erwerben.
|
|
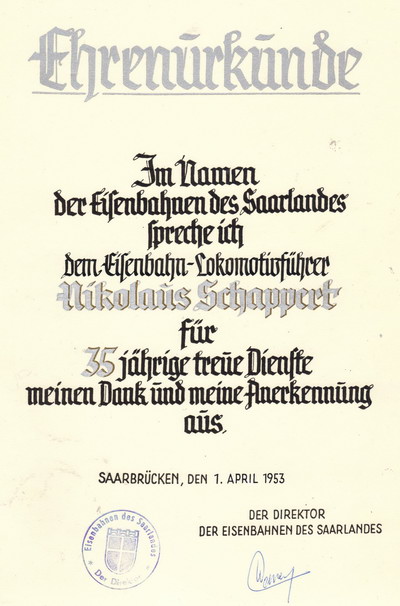
|

|
Abbildung
links:
Der
Lokomotivführer Nikolaus Schappert befuhr bis
zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst im Jahr
1963 als Oberlokführer des BW St Wendel mit
"seiner" P8 (Baureihe 38) überwiegend die
Strecke Saarbrücken-Bingerbrück.
Am 1.
April 1953 wurde er vom Direktor der EdS
anlässlich seines 35-jährigen Dienstjubiläums
mit dieser Urkunde geehrt. (W. Linnenberger)
|
|
|
|

|
In diesem SEB-Fahrplan von
1951 fanden die Kunden
neben den offiziellen
Angaben auch einige kluge Sprüche:
(Fahrplan zur Verfügung
gestellt von Norbert König)
|
|

|
|

|
|

|
|
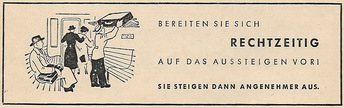
|
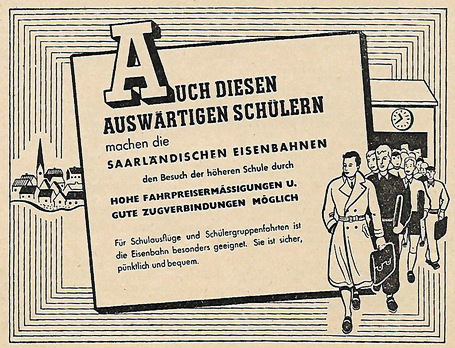 
Die SEB werben für
Fahrten auswärtiger Schüler zum Besuch von höheren Schulen
und Schülergruppenfahrten, und für Reisen in beliebte
Urlaubsorte.
|
K)
Modell - Eisenbahnen
 Ich erinnere mich
gerne an die Vorweihnachtszeit in den 50er Jahren. Als
anfangs etwa sechsjähriger Knirps verbrachte ich jedes
Jahr im Dezember viele Nachmittage im "NK"
(Neunkircher Kaufhaus) in der Stummstraße, heute
Kaufhof. Dort war in einem der Räume eine riesengroße,
wunderschöne elektrische Modelleisenbahn-Anlage
aufgebaut. Viele andere Kinder (klar, hauptsächlich
Jungs) und mindestens genauso viele Väter, Mütter,
Opas und Omas drängten sich um das "Objekt der
Begierde". So kann man es sicher nennen, denn nicht
viele Kinder durften sich über solch ein großartiges
Weihnachtsgeschenk freuen. (Rainer
Freyer) Ich erinnere mich
gerne an die Vorweihnachtszeit in den 50er Jahren. Als
anfangs etwa sechsjähriger Knirps verbrachte ich jedes
Jahr im Dezember viele Nachmittage im "NK"
(Neunkircher Kaufhaus) in der Stummstraße, heute
Kaufhof. Dort war in einem der Räume eine riesengroße,
wunderschöne elektrische Modelleisenbahn-Anlage
aufgebaut. Viele andere Kinder (klar, hauptsächlich
Jungs) und mindestens genauso viele Väter, Mütter,
Opas und Omas drängten sich um das "Objekt der
Begierde". So kann man es sicher nennen, denn nicht
viele Kinder durften sich über solch ein großartiges
Weihnachtsgeschenk freuen. (Rainer
Freyer)
|
Wolfgang
Linnenberger schreibt, dass auch er oft dort
gewesen sei. Er kennt sich in dieser Materie
gut aus und berichtet:
Die
alte Modellbahnanlage, die jedes Jahr vor
Weihnachten im Neunkircher Kaufhaus aufgebaut
wurde, bestand überwiegend aus Märklin-Vorkriegsmaterial
der
Spurweite Null. Da die Spur-Null-Artikel der
französischen Hersteller JEP und HORNBY mehr
oder minder kompatibel waren und neues
Märklin-Material aus Deutschland im Saarland
damals nicht mehr zu beschaffen war, fuhren
auf der Anlage nur diese neuen französischen
Artikel. Ich kann mich aber noch ganz genau an
die großen Mengen Märklin-Materials erinnern,
das im Hintergrund als Staffage diente. Wenn
ich vor Weihnachten ins NK kam, habe ich mich
dort immer ein paar Stunden festgebissen
Nach
der Saarabstimmung 1955 war diese Anlage
plötzlich verschwunden! Auch hartnäckige
Nachfragen seinerzeit beim NK wurden stets
negativ beschieden. Nach nur einem Jahr konnte
sich dort niemand mehr daran erinnern!!??
Fragen
an
unsere Leser: Hat jemand noch Bilder von
dieser Anlage im NK? Wer weiß, wo die
Anlage oder Teile davon verblieben sind?
>Kontakt
Hinweis zu den
beiden Farbfotos rechts: Sie dienen nur zur
Illustration und zeigen nicht etwa die
Eisenbahn im Neunkircher Kaufhaus! (Fotos:
FrançoisTouret)
|

|
|
Eine
andere große Modellbahnanlage wurde 1952 in
der großen Halle des Bexbacher
Blumengartens innerhalb der Ausstellung
"Eisenbahnen des Saarlandes - einst und
jetzt" gezeigt. Anlass für die
Ausstellung war das 100-jährige Jubiläum der
Eröffnung der Strecke Bexbach - Saarbrücken am
16. November 1852. Die Modellbahnanlage hatte
der "Modell-Eisenbahnclub e.V. Saarbrücken -
Signalwerkstätte" aufgebaut.
|

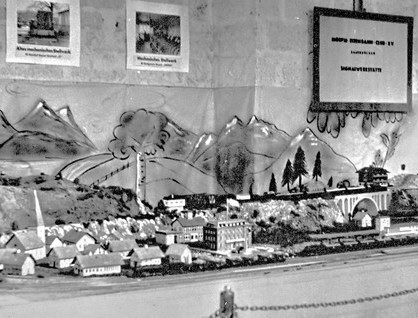
(Fotos: Sammlung R. Freyer)
Mehr
über die Ausstellung im Bexbacher Blumengarten
finden Sie auf der Seite Große
Eisenbahn- und Postausstellung 1952.
|
|
|
Karl Presser hat seine Weihnachtsgeschenke aus
dem Jahr 1956 bis heute sorgfältig aufbewahrt.
|

|
|

|
|
Er berichtet:
Mein Vater hatte für horrende 22 000 frs. diese
Märklin- Eisenbahn-Packung SK 8464 in Saarbrücken ergattert.
Der Import deutscher Spielwaren ins Saarland war
kontingentiert; der Preis entsprach etwa dem Gegenwert
von drei Herren-Anzügen oder mehr als dem halben
Netto-Monatsgehalt eines Angestellten.
Die Märklin
Schlepptender-Stromlinienlokomotive SK 800 ist der
Baureihe 06 der Deutschen Reichsbahn nachempfunden.
Im Gegensatz zum Vorbild hat das Modell statt vier
jedoch nur drei Treibachsen.
Das Modell ist
aus Zink-Druckguß. Es wurde in mehreren Varianten und
Farben von 1939 bis 1959 bei Märklin gebaut, wiegt
etwa 900 g und ist rund 30 cm lang. Die Ausführung wie
hier mit Haftreifen gab es nur von 1954 bis 1958. Die
Lok weist auch heute noch keinerlei Anzeichen von
Materialzersetzung durch Zinkpest auf.
(Zwei Fotos
oben: Karl Presser)
Danke für Infos auch an
Lothar Steitz und Wolfgang Linnenberger
|

Verschiedene
Generationen von Märklin-Schienen. (Foto: Fr.
Touret)
|
|
L)
Persönliche Erinnerungen
an die Loks der Saar-Eisenbahnen
a) Jean Kind berichtet über die
Lok der Baureihe 42 (siehe dazu auch seinen
Lageplan auf der Seite Lagera!)
Ich erinnere mich sehr gut
an die mächtige fünfachsige Dampflok der 42er
Reihe mit den großen kohlenbeladenen
Wannentendern. Damals, nach 1945, führten die
Eisenbahngleise in Saarbrücken durch die Kurve der
Straße zwischen "Am Römerkastell" und "An der
Römerbrücke". Beidseitige Schranken gingen
herunter, wenn ein Güterzug vorbeifuhr. Mehrere
Gleise versorgten dort den riesigen Rangierhof zur
Belieferung der Lagera, des Schlachthofs, des
ehemaligen ARAL-Benzinlagers, der Großmarkthalle
und verschiedener Schrotthandlungen. Die Lok
brachte die vollgeladenen Züge von Brebach zum
Rangierhof hinunter und schleppte später den
langen Zug der abgeladenen Waggons wieder nach
Brebach zurück. Dies geschah zwei- oder dreimal in
der Woche.
Das Wohnhaus bei der
LAGERA, in dem meine Eltern eine
Wohnung im zweiten Stock hatten, war nur einen
Meter von den Hauptgleisen entfernt, so dass das
ganze Haus zu zittern begann, jedesmal wenn die
Riesenlok dort vorbeifuhr. Der Lärm der Kupplungen
des Zuges, das laute Puffen der Lokomotive und das
"Erdbeben", das sie entwickelte, weckten mich
morgens gegen sechs Uhr auf und warfen mich
jedesmal aus meinem warmen Bett. Da ich zwei
Kilometer zur Schule gehen musste, kam ich
deswegen immer schon vor acht Uhr in der
Bismarckschule (Ecke Schillerstraße-Rosenstraße)
an, niemals zu spät, und ich hatte unterwegs
genügend Zeit, um für den Unterricht zu lernen:
Das war mein großes Glück und ein wichtiger
Vorteil!
In den 50er-Jahren lernten wir in der Oberstufe
des Marschall-Ney-Gymnasiums das thermodynamische
Funktionieren der Dampflok. Es wurde berechnet,
dass eine DR-Lok der 52er-Reihe (die leicht
geändert als 42er im Saarland benutzt wurde) bis
zu 1800 PS entwickeln und mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/Stunde fahren
konnte. Beim Anfahren musste sie einen
1000-Tonnen-Zug mit 0,104 m/sec/sec beschleunigen.
Die Steigung, die sie ohne zu rutschen mit einem
solchen Zug befahren konnte, durfte nur etwa 1,1%
betragen. Da habe ich verstanden, warum die langen
Kohlen- und Erzzüge am Römerkastell völlig "außer
Atem" anhalten mussten, um wieder Dampfdruck zu
erzeugen, und warum die Räder der Lok beim
Anfahren so brutal auf den Schienen ins Rutschen
kamen.
(Jean
Kind, Sélestat / Schlettstatt im Elsass)
b) Lothar Steitz
hat ähnliche Erinnerungen an seine Kinderzeit in
den 50er-Jahren:
Ein Exemplar der Baureihe 57
hatte im Bahnhof Brebach regelmäßig die Aufgabe,
schwere Schlackenzüge der Halberger Hütte in
Richtung Haupt- oder Güterbahnhof zu ziehen; eine
Aufgabe, der diese relativ kleine Lokomotive kaum
gewachsen war. Es war jedenfalls ein wahres Drama
mitzuverfolgen, wie diese Maschine mit letzten
Reserven den Zug ins Rollen und in mäßige Bewegung
brachte. Ich wohnte damals am Kieselhumes und
hörte zuerst nur die Auspuffschläge, die bei
voller Füllung*) weithin hallten, aber anfangs in
Abständen von fünf Sekunden aufeinander folgten
und unendlich langsam schneller wurden, nur
gelegentlich heftig beschleunigt, wenn die
Treibräder schleuderten. Die Lokführer müssen
wahre Künstler gewesen sein, die kleine Lokomotive
mit dem schweren Zug so konzentriert und geduldig
anzufahren, bis sie sich mühsam durch den
Ostbahnhof schob. Erst dort konnte ich sie nämlich
sehen, wie sie aus allen Fugen zischte und
ungeheure Dampfwolken ausstieß, aber immer weiter
in mäßigen Trab kam. Ich habe nie mehr eine
Maschine so am Rand ihrer Reserven betrieben
gesehen. – In Brebach wurde die Baureihe 57
schließlich durch Dampflokomotiven der Baureihe 50
und später durch Diesel-Lokomotiven der Baureihe
218 ersetzt, die die Schlackenzüge der Halberger
Hütte ganz unspektakulär wegzogen.
(Lothar Steitz, er wohnt heute
in Visselhövede, Niedersachsen)
*) Erläuterung für
Nicht-Eisenbahner: Mit "Füllung" ist der Grad der
Zylinderfüllung gemeint, wie er durch die Steuerung
dosiert wird. Bei voller Füllung (also ganz
ausgelegte Steuerung) wirkt der aktuell im Kessel
herrschende Dampfdruck über den gesamten Weg des
Zylinders, und der Auspuff ist am lautesten.
|
|
Quellenangaben
und Literaturhinweise zu dieser Seite:
Ausführliche Informationen
über die Entwicklung der Eisenbahnen im Saarland von
den Anfängen (um 1850) bis heute finden sich u.a. in:
- Kurt
Harrer: Eisenbahnen an der Saar - Eineinhalb
Jahrhunderte Eisenbahngeschichte zwischen Technik und
Politik. Düsseldorf 1984
- Kurt
Hoppstädter: Die Entstehung der saarländischen
Eisenbahnen. Veröffentlichungen des Instituts für
Landeskunde des Saarlandes 2;
Saarbrücken
1961.
- Zeitschrift
Eisenbahn-Kurier
EK Special Nr. 86, 3. Quartal 2007: Die Eisenbahn
im Saarland
(www.eisenbahn-kurier.de)
- Eisenbahnoberrat
Halm: Die Eisenbahnen des Saarlandes. In:
Wirtschaftliches und kulturelles Handbuch
des Saarlandes.
Saarbrücken
1955. Seite 207 ff.
- Engelbert
Zimmer: Die Saarbrücker Eisenbahnverwaltung im
Wandel der Zeit 1847 - 1957
Mitteilungen für den
saarländischen
Eisenbahner. Sondernummer. Saarbrücken, Oktober 1959
- Ankunft
Saarbrücken Hbf... 150 Jahre Eisenbahn an der Saar.
Hgg.
vom Chef der Staatskanzlei
Landesarchiv in Zusammenarbeit
mit dem Historischen Museum Saar
und dem Stadtarchiv Saarbrücken.
Bearbeitet von Michael Sander. Saarbrücken 2002
|
>
Übersichts-Seite des
Kapitels VERKEHR
nach
oben

|
 zurück <---------> weiter zurück <---------> weiter

wwwonline-casino.de
(Gesamt seit 2008)
Home
(zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de
|

 Man begann mit dem Bau der Strecke von
Ludwigshafen durch die Pfalz nach Saarbrücken, und im
Juli 1848 erreichte zum ersten Mal eine Dampflok, von
Kaiserslautern kommend, bei Homburg das Gebiet des
heutigen Saarlandes. Die Strecke wurde nun zunächst
bis Bexbach weitergebaut, und im Juni 1849 zog
erstmals eine Dampflok einen Zug vom neu erbauten
Bahnhof Bexbach aus nach Homburg (siehe Bild
rechts). Im August 1849 war schließlich die
ganze Strecke von der Rheinschanze bei Ludwigshafen
bis Bexbach durchgehend befahrbar. 1852 wurde die
Strecke von Metz über Saarbrücken nach Neunkirchen
eröffnet, und schon 1860 waren auch die Verbindungen
von Saarbrücken nach Trier und durch das Nahetal nach
Kreuznach fertiggestellt. (Bild: Modellbahnfreunde Bexbach e.V.)
Man begann mit dem Bau der Strecke von
Ludwigshafen durch die Pfalz nach Saarbrücken, und im
Juli 1848 erreichte zum ersten Mal eine Dampflok, von
Kaiserslautern kommend, bei Homburg das Gebiet des
heutigen Saarlandes. Die Strecke wurde nun zunächst
bis Bexbach weitergebaut, und im Juni 1849 zog
erstmals eine Dampflok einen Zug vom neu erbauten
Bahnhof Bexbach aus nach Homburg (siehe Bild
rechts). Im August 1849 war schließlich die
ganze Strecke von der Rheinschanze bei Ludwigshafen
bis Bexbach durchgehend befahrbar. 1852 wurde die
Strecke von Metz über Saarbrücken nach Neunkirchen
eröffnet, und schon 1860 waren auch die Verbindungen
von Saarbrücken nach Trier und durch das Nahetal nach
Kreuznach fertiggestellt. (Bild: Modellbahnfreunde Bexbach e.V.) 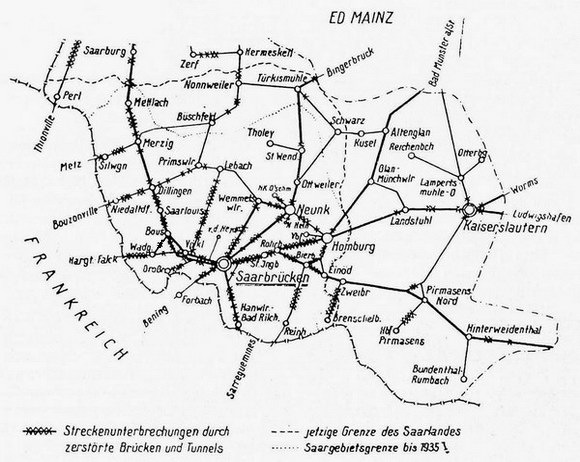
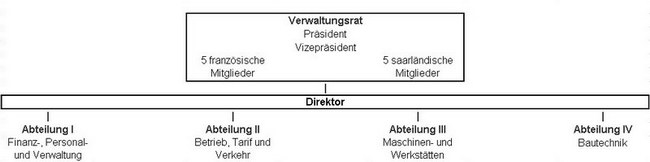


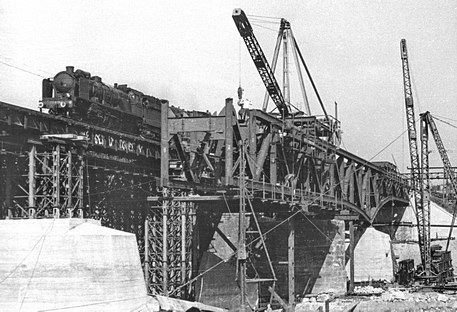

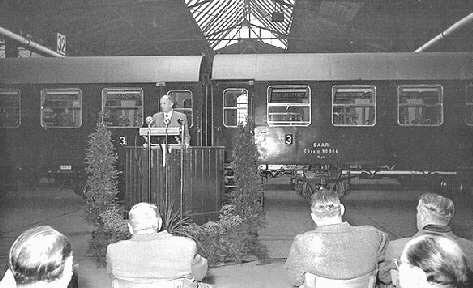
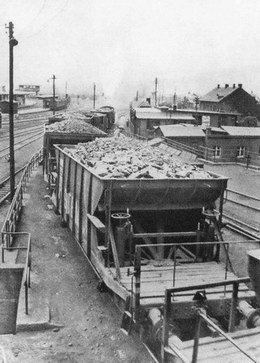


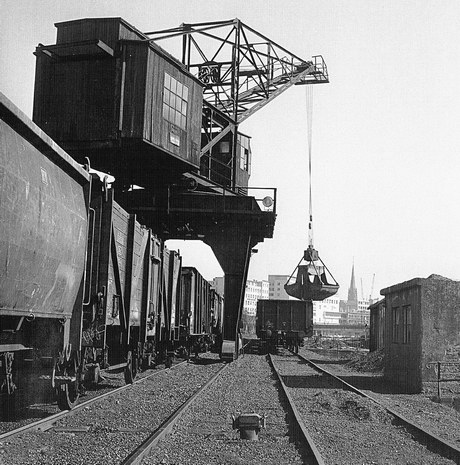

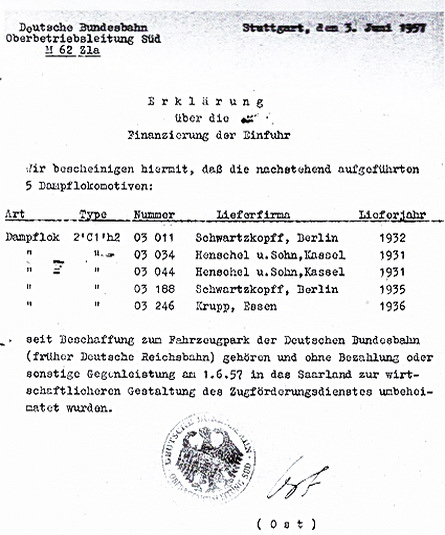

 Vollkommen
vergeblich war aber der Versuch der DB,
sechs Güterzug-Lokomo- tiven der Baureihe 44
schon vor dem Tag X ins Saarland zu
überstellen. Schwere Kohlenzüge mussten
daher weiterhin mit Vorspann-Lokomotive und manchmal auch
mit zusätzlicher Schiebelok durch die
Grubensenkungen auf der Sulzbach- und
Fischbachtalstrecke gezogen werden.
Vollkommen
vergeblich war aber der Versuch der DB,
sechs Güterzug-Lokomo- tiven der Baureihe 44
schon vor dem Tag X ins Saarland zu
überstellen. Schwere Kohlenzüge mussten
daher weiterhin mit Vorspann-Lokomotive und manchmal auch
mit zusätzlicher Schiebelok durch die
Grubensenkungen auf der Sulzbach- und
Fischbachtalstrecke gezogen werden.