|
Dieser
Text befasst sich mit der Entwicklung des Telefonwesens in der
Saarstaatzeit. Zum besseren Verständnis beginnt er mit einem Blick auf
die Einführung des Selbstwählverkehrs von den 1920er-Jahren an.
Die ersten Telefone an der Saar
wurden
im Bereich der damaligen Preußischen Grubenverwaltung mit
Handvermittlung eingerichtet, beginnend 1884/85 im Übertagebereich der
Grube
Heinitz. [1]
Über
40 Jahre später
wurde dann das erste Wählamt im damals unter Völkerbundverwaltung
stehenden
Saargebiet 1927 in Neunkirchen in Betrieb genommen. Diese nach dem
französischen System Thomson-Houston errichtete Wählvermittlung besaß
Wähl-Unterämter in Landsweiler und Ottweiler; alle Teilnehmer konnten
sich bei
„verdeckter Nummerierung“ [2]
in Selbstwahl erreichen. Auch das danach in Püttlingen errichtete Amt
wurde
nach diesem System gebaut. Es folgten weitere Wählämter, bei denen die
Technik
von Siemens & Halske zum Zuge kam, u.a. in Bous, Dillingen,
Mettlach,
Saarbrücken, Saarlouis, Saarwellingen, St. Ingbert und Sulzbach. Wegen
haushaltsmäßiger Schwierigkeiten der OPD des Saargebietes ließ sich
allerdings der Plan, bis zum Ende der Völkerbundszeit alle wichtigen
Vermittlungsstellen von Hand- auf Wählbetrieb umzustellen, nicht
verwirklichen [3].
Immerhin aber war es
bis 1935 gelungen, die für die Einrichtung des Schnellverkehrs [4]
erforderlichen Gruppennetze nach dem Siemens-System für Neunkirchen,
Saarbrücken und Saarlouis in den Grundzügen festzulegen und den
vollautomatischen Selbstwähl-Fernverkehr zwischen den Fernsprechteilnehmern von
Neunkirchen und Saarbrücken aufzunehmen. Das dazu notwendige Bezirkskabel war
1931 zwischen Saarbrücken, St. Ingbert und Neunkirchen von der AEG verlegt
worden. [5]
|
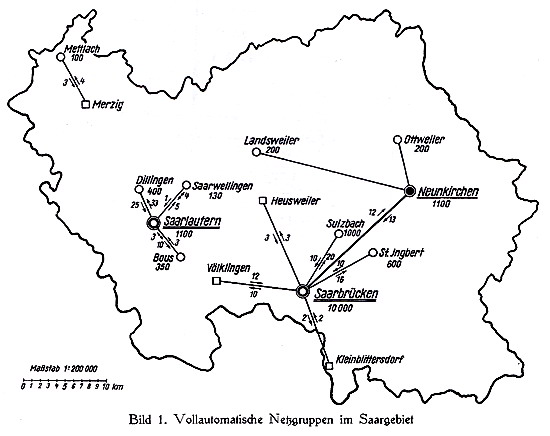
|
Bild 1: Vollautomatische Netzgruppen im Saargebiet 1935
Legende:
-
Zahl bei Pfeilen: Anzahl der Leitungen für in Pfeilrichtung mögliche
Anrufe (z.B. 12 Leitungen für Selbstwahl-Anrufe von Sbr. nach Nk. und
13 Leitungen für solche von Nk. nach Sbr.)
-
Zahlen unter den Ortsnamen: Anzahl der Anschlüsse im betreffenden
Ortsnetz (und zwar Anzahl der technisch möglichen, die aber nicht immer
schon eingerichtet sein müssen).
(Bild: R. Hoefert,
Das Fernsprechwesen auf dem Lande und die Bildung von
Land-Fernsprech- Netzgruppen, in: Fortschritte der Fernsprechtechnik Siemens
& Halske AG Berlin, Nr. 13, Januar 1935, Seite 28)
|
--------------------------
[1] Thomas
Herzig, Geschichte der Elektrizitätsversorgung des Saarlandes, Saarbrücken
1987, S. 28.
[2] Verdeckte
Nummerierung bedeutet, dass Teilnehmer auch für Verbindungen z.B. von
Neunkirchen nach Ottweiler keine zusätzliche Ortsnetzkennzahl vorwählen mussten,
weil die Telefonnummern aller Teilnehmer von Neunkirchen und von Ottweiler mit
jeweils unterschiedlichen Ziffern begannen.
[3] Schilly,
Geschichte des Post- und Fernmeldewesens im Saarland 1920–1970, in: Archiv
für Deutsche Postgeschichte 1971, Heft 2, S. 16.
[4]
Unter
Schnellverkehr wird im Handvermittelten Fernverkehr eine Abwicklung
verstanden, bei der die Vermittlungsbeamtin des Fernamts die Verbindung
für den anfordendenTeilnehmer sofort durch Wahl herstellt, dieser also
nicht mehr erst einige Zeit
nach Anmeldung mittels Rückruf verbunden wird.
In den Jahren nach
1935
wurden unter der jetzt wieder deutschen Verwaltung weitere Handämter auf
Wählvermittlung umgestellt, u.a. Buß (= Bous),
Ensheim, Hemmersdorf, Heusweiler, Ittersdorf, Karlsbrunn, Kleinblittersdorf,
Mettlach, Oberthal, Ommersheim, Reimsbach, Saarwellingen, Schmelz-Bettingen,
Steinbach bei Lebach, Sulzbach und Tholey, wie man dem letzten Telefonbuch vor
Kriegsende, dem "Amtlichen
Fernsprechbuch für den Bezirk der
Reichspostdirektion Saarbrücken 1942" entnehmen kann.
Handvermittlungen
besaßen dagegen 1942 noch Städte wie Blieskastel, Homburg, Illingen, Lebach,
Merzig, St. Wendel und Völklingen.
Für die Teilnehmer
der Städte Saarbrücken, Neunkirchen (mit Landsweiler und Ottweiler), St.
Ingbert und Sulzbach untereinander war 1942 der Selbstwähl-Fernverkehr möglich. Dabei erreichten die Teilnehmer von
Saarbrücken, St. Ingbert und Sulzbach die Ortsnetze Ensheim, Heusweiler,
Kleinblittersdorf, Neunkirchen, Ommersheim, Saarbrücken, St.
Ingbert und Sulzbach bereits mit einheitlichen Ortsnetz-Kennzahlen. Nur für die
Teilnehmer von Neunkirchen (incl. Landsweiler und Ottweiler), die ebenfalls die
Teilnehmer dieser Netze in Selbstwahl erreichten, galten andere
Ortsnetz-Kennzahlen, vermutlich wegen der in Neunkirchen verwendeten
Thomson-Houston-Technik.
|
Bemerkenswert ist, dass diese Selbstwählferngespräche nach 6 oder 12
Minuten automatisch getrennt wurden, worauf zuvor ein kurzer hoher Summerton
aufmerksam machte. Ein Ortsgespräch kostete 0,10 Reichsmark.
An
nicht-postdienstlichen Sondernummern [6]
gab es 1942 in Saarbrücken die Kurzrufnummern Feuer 012, Überfall 011 und
Zeitansage 019.
Überschlägig bestanden 1942 ca. 35.000 Telefonanschlüsse im Saarland.
Bild 2: Verzeichnis der Ortsnetz-Kennzahlen 1942
|
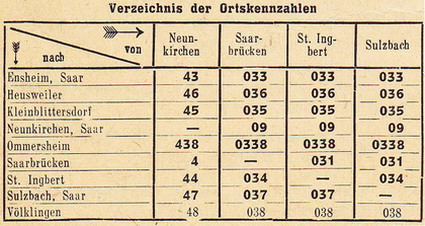
|
______________________
[6] Wie
Auskunft, Vermittlung, Fernamt, Anmeldestelle und Störungsstelle.
Stand 1947:
Erstaunlicherweise
muss die Automatisierung weiterer Ortsnetze noch in den letzten Kriegsjahren
nach 1942 weitere Fortschritte gemacht haben, weist doch das mit Stand 15.
Februar 1947 herausgegebene „Amtliche
Fernsprechbuch für den Bezirk der Oberpostdirektion Saar 1947“ u.a. auch
die Ortsvermittlungen von Losheim, Merzig, St. Wendel, Völklingen und Wadern
als Wählvermittlungen aus. Man kann wohl ausschließen, dass diese Umstellung
auf Wählvermittlung erst nach dem Kriegsende erfolgte.
|
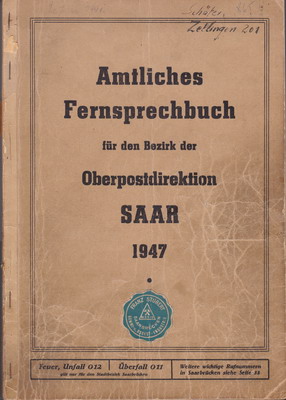
|
Von
den größeren
Städten des Saarlandes wurde im Jahr 1947 nur Homburg weiterhin noch
handvermittelt. Es könnte aber auch sein, dass Homburg genau so wie die
vorgenannten größeren Städte des Saarlandes schon nach
1942 auf Wählbetrieb umgestellt war, und dass dieses Wählamt dann aber
in den letzten
Kriegsmonaten wieder zerstört worden war. Schließlich war auch das
bereits seit 1927 wählvermittelte Ortsnetz Neunkirchen nach dem Krieg
wieder
handvermittelt, weil bereits am 30. November '44 die automatische Fernsprechvermittlung durch feindliche Sprengbomben völlig zerstört worden war.
Den Kriegsauswirkungen war es auch sicherlich geschuldet, dass 1947 die Nummern im
Ortsnetz Saarbrücken nun nur noch 4-stellig (1942: 5-stellig) und die von
Neunkirchen nur noch 3-stellig (1942: 4-stellig) waren. Die geringere
Teilnehmerzahl erlaubte nun diese Reduzierung; durch sie konnte man teure
Gruppenwähler einsparen, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Einrichtungen
in diesen Ortsnetzen vielfach beschädigt, zum Teil auch zerstört gewesen sein
mussten.
Das links abgebildete
Nachkriegs-Fernsprechbuch von 1947 erlaubt einen fundierten Überblick über das
damalige Telefonwesen des Saarlandes. So gab es bereits wieder ca. 28.000
Teilnehmer für ein Saarland, das allerdings gegenüber 1942 im nördlichen Bereich deutlich
vergrößert worden war; denn dort waren nach dem Krieg auf Anordnung des französischen
Militärbefehlshabers 142 Gemeinden mit 80.000 Einwohnern dem Saarland von 1935
hinzugeschlagen worden [7].
Bild 3: Amtliches Fernsprechbuch der Oberpostdirektion SAAR von 1947 (Foto: D.Arbenz)
|
-------------------------------
Interessant ist,
dass 1947 der Selbstwählferndienst zwischen Teilnehmern von Saarbrücken, St.
Ingbert, Sulzbach wieder so wie bereits 1942 funktionierte; hinzugekommen zu
dieser Netzgruppe waren aber gegenüber 1942 die Teilnehmer des Ortsnetzes Völklingen.
Ein Ortsgespräch
kostete Anfang 1947 nunmehr 0,15 Reichsmark.
An nicht-postdienstlichen
Sondernummern gab es in Saarbrücken 1947: Feuer/Unfall: 012, Überfall: 011 und
Zeitansage: 019; dies waren dieselben Nummern wie schon 1942.
Auf zwei
Besonderheiten soll noch hingewiesen werden:
-
Selbstgewählte Ferngespräche wurden nach sechs Minuten und einem
vorausgehenden kurzen hohen Summerton automatisch getrennt. Diese auch
schon vor dem Krieg übliche Begrenzung war der Tatsache geschuldet,
dass die im Fernverkehr verwendeten Gebühren- Erfassungseinrichtungen
aus Kostengründen nicht für eine kostengerechte Erfassung längerer
Ferngespräche ausgelegt waren.
- Fernsprechanschlüsse konnten in der Nachkriegszeit ohne Entschädigung
aufgehoben und damit dem Inhaber entzogen werden, wenn deren Einrichtungen im Amt
oder die Leitung für dringende Zwecke (z.B. für die Besatzungsbehörden)
benötigt wurden.
______________________
Stand 1955:
In den neun Jahren von 1947 bis 1955 war das saarländische Telefonnetz kontinuierlich angewachsen: das Amtliche Fernsprechbuch 1955 von der Post-
und Telegraphenverwaltung des Saarlandes mit Stand vom 1. Juli 1955 enthielt nunmehr ca. 78.000 Teilnehmer. Das Netz
hatte sich also gegenüber 1947 knapp verdreifacht. Dies entsprach einem
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14 %. 1955 waren alle Ortsämter
vollautomatisiert; auch alle innersaarländischen Ferngespräche konnten von den
Teilnehmern selbst gewählt werden.
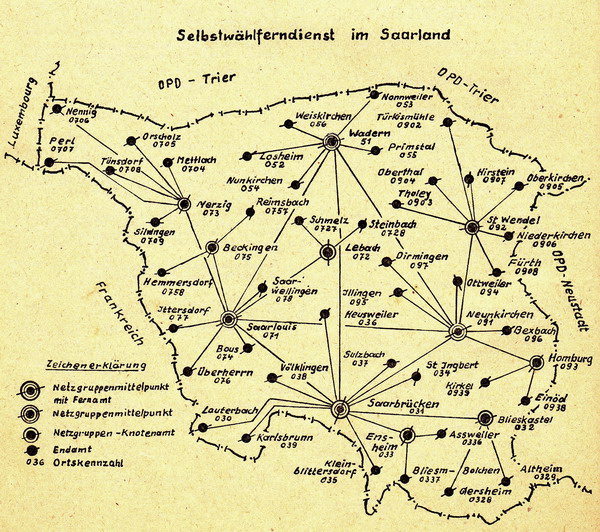
Bild 4: Selbstwählferndienst und Ortsnetzkennzahlen (ONKZ) im Saarland 1955
Es gab 1955 eine
klar gegliederte Netz-Hierarchie (siehe Bild oben). Die oberste Ebene bildeten vier Netzgruppen,
deren Mittelpunkte untereinander voll vermascht waren: Saarbrücken (031) -
gleichzeitig Fernamt, Saarlouis (071), Neunkirchen (091) und Wadern (051); von
den Mittelpunkten dieser Netzgruppen führten die Leitungen sternförmig zu den
angeschlossenen Knoten- und Endämtern.
Ortsgespräche (beliebiger Länge) - kosteten 15 Franken, was dem Preis für eine Gesprächseinheit
entsprach. Bei innersaarländischen Ferngesprächen konnte man je Gesprächseinheit entfernungsabhängig 90, 60,
45 bzw. 30 Sekunden sprechen; letzteres galt für Verbindungen über mehr als 45
km.
Gespräche nach
Frankreich, dem das Saarland ja wirtschaftlich angeschlossen war, waren - alle
noch handvermittelt - vergleichsweise kostengünstig; ein Drei-Minuten-Gespräch
über eine Entfernung von 150 km kostete z.B. 105 Franken.
Dagegen waren Gespräche in die Bundesrepublik als Auslandsgespräche teuer; ein
vergleichbares Drei-Minuten-Gespräch nach Deutschland kostete 225 Franken. Die
Qualität der Fernverbindungen war gut, war doch Saarbrücken schon seit 1930 mit
einem Verstärkeramt in das Fernkabel von Frankfurt a.M. nach Paris eingeschaltet.
Von den
Nicht-Fernsprechdienst-nahen Sonderdiensten gab es mit Kurznummer Zeitansage, Totoansage [8],
Küchendienst (mit Kochvor- schlägen), Kino-, Theater- und Veranstaltungsdienst
sowie einen Wetternachrichtendienst.
--------------------
[8] Das Sport-Toto (oder Fußball-Toto) war auch schon im damaligen Saarland eine sehr populäre Form der Wette auf den Ausgang
von Fußballspielen.
Im vierstellig nummerierten Ortsnetz Völklingen
gab es nunmehr eine Besonderheit: die nur 2-stellige Rufnummer „35“ für die Völklinger
Hütte, die 1955 noch unter dem Namen „Administration Séquestre des
Röchling’sche Eisen- und Stahlwerke GmbH, Völklingen-Saar“ im Telefonbuch
firmierte. Ob die Kurz-Nr. „35“ zur Ersparnis von
Leitungswählern, zur Einrichtung einer Groß-Sammelnummer oder aber in Vorbereitung auf eine Durchwahl-Nebenstellenanlage
eingerichtet worden war, ist heute schwer abzuschätzen; festzuhalten ist in
diesem Zusammenhang, dass es im Saarland bis dahin überhaupt keine
Durchwahl-Nebenstellenanlagen gab.
Der so genannte "Wählton"
(von Laien manchmal fälschlicherweise "Freizeichen" oder "Amtston"
genannt) ist heute ein ununterbrochener Dauerton. Früher bestand er
aber aus einem kurzen Ton, einer kurzen Pause und einem langen Ton (wie
das Morsezeichen für "A", was wohl "Amt" bedeuten sollte). Er hörte
sich damals (bei der Bundespost noch bis 1979) so an:
 Alter Wählton
(bitte Ihren PC-Lautsprecher einschalten und ggfls. auf Nachfrage
"Quicktime"
o.ä. erlauben!) Alter Wählton
(bitte Ihren PC-Lautsprecher einschalten und ggfls. auf Nachfrage
"Quicktime"
o.ä. erlauben!)
Abhörzwischenfall im Fernsprechamt
Saarbrücken
Politische
Wellen
schlug 1955 ein Vorfall um die wohl schon seit 1946/47 bestehende
Abhörpraxis
durch die französische Sûreté, die auch noch nach Abschluss der
Teil-Autonomie-Verträge
vom 20. Mai 1953 von Frankreich fortgesetzt wurde, und zwar mit
Zustimmung oder zumindest (erzwungener?) Duldung der saarländischen
Regierung. Und dies, obwohl sie der 1947 verabschiedeten Verfassung des
Saarlandes widersprach, deren Artikel 17 [9] das Fernmeldegeheimnis
unter Schutz stellte.
Am 17. April 1955
stellte sich der Leiter des Fernsprechamtes in der Saarbrücker Dudweilerstr. 17, Postrat Karl-Heinz
Schneider, zusammen mit einigen Mitarbeitern zwei postfremden Personen in den
Weg, die in gewohnter Weise Abhörleitungen vom Hauptverteiler des
Fernmeldeamtes zu einem speziellen Kontrollraum schalten wollten. In diesem
Raum, der von Mitarbeitern der saarländischen Postverwaltung nicht betreten
werden durfte, erfolgte Abhören und Bandaufzeichnung der abgehörten Gespräche.
Um den Verfassungsanspruch durchzusetzen, rief Schneider damals das
Überfallkommando zu Hilfe - dieses war jedoch machtlos, weil die beiden
betreffenden Personen ein u.a. vom saarländischen Innenminister Hector
unterzeichnetes Schriftstück vorzeigten, das alle saarländischen Dienststellen
zur Unterstützung anwies. Dennoch ließ Schneider das Kabel zum Kontrollraum
kurzerhand kappen.
Wie sich
herausstellte, gehörten die zu diesem Zeitpunkt abzuhörenden 77 Anschlüsse zum
einen wichtigen Personen oder Organisationen der saarländischen Wirtschaft, zum
anderen Personen der politischen Opposition zur Regierung Hoffmann, die mit
dessen Kurs der Abtrennung des Saarlandes von der Bundesrepublik nicht
einverstanden waren. Pikant war dabei, dass auch Persönlichkeiten wie der
damalige päpstliche Visitator, Monsignore Michael Schulien, abgehört wurden. [10]
Mehr zum Thema Geheimpolizei, Sûreté, Telefonüberwachung usw. können Sie demnächst im Polizeikapitel von Saar-Nostalgie lesen.
|
1958/60: Integration des
saarländischen Selbstwahlnetzes in das bundesdeutsche Netz
Nach der Eingliederung der Saar in die Bundesrepublik wurde für das
vollautomatische saarländische Netz eine abschließende größere Umstellung
erforderlich, weil sich dessen Ortsnetzkennzahlen mit denen des bundesdeutschen
Netzes überschnitten. Beispiel: Mit der Wahl von 091x wurde in der Bundesrepublik
von überall her ein Teilnehmer im Großraum Nürnberg bzw. in Franken erreicht,
während von Saarbrücken aus mit der 091 die Teilnehmer von Neunkirchen/Saar
angewählt wurden.
Die Integration der beiden Netze geschah nun in mehreren
Schritten:
- Zuerst wurde im
Saarland bei allen innersaarländischen Ortsnetzkennzahlen (ONKZ - siehe Bild 4!)
in einem
Zwischenschritt die führende 0 durch eine 9 ersetzt. Von Saarbrücken
aus erreichte
man dann z.B. Neunkirchen über die Vorwahl 991 (statt der bisherigen
091), Mettlach über 9704 (statt 0704), usw. Diese Kurzvorwahlen mit
beginnender 9 konnten wahrscheinlich bis etwa 1965 weiterbenutzt werden.
- Danach wurden die
saarländischen Fernwahl-Einrichtungen so erweitert, dass man auch vom Saarland
aus alle bundesdeutschen Anschlüsse unter
ihrer bestehenden ONKZ - und gleichermaßen bereits viele ausländischen
Anschlüsse - in Selbstwahl mit der beginnenden 0 erreichen konnte.
-
In einem weiteren Schritt erhielten
alle saarländischen Ortsnetze neue Ortsnetzkennzahlen, die mit "068"
begannen. Sie konnten auch im innersaarländischen Verkehr verwendet
werden. Dann wurden die Ämter in der Bundesrepublik um die Richtung
"068x" erweitert, damit man von überall her die saarländischen
Teilnehmer erreichen konnte.
Mit diesen Maßnahmen war nach 1959/60 die Integration des
saarländischen Telefonnetzes in das bundesdeutsche Netz abgeschlossen, und die
Saarländer konnten wie jeder andere Anschlussinhaber in der BRD am bundesdeutschen
Selbstwählferndienst teilnehmen.
|
|
Telefonapparate in den 40er- und 50er-Jahren
Zum
Schluss noch ein
Wort zu den Telefonapparaten im damaligen Saarland: In den ersten
Nachkriegsjahren bestimmten weiterhin die schwarzen Wählapparate vom
Typ W28
der Reichspost das Bild - ohne „weißes Knöpfchen“ für
Wohnungsanschlüsse, „mit Knöpfchen“ für den Einsatz bei Industrie und
Verwaltung.
Ab den 1950er Jahren kamen dann auch die schwarzen Einheitsfernsprecher der Deutschen Bundespost vom Typ W48 hinzu (Bild unten). Französische Apparate wurden im Saarland nicht eingesetzt, weil deren Technik nicht zu dem bei uns verwendeten deutschen System passte (11).
Bild 5: Fernsprecher W28 aus der Vorkriegszeit, im Saarland der
1950er Jahre noch weit verbreitet. Foto: Dietrich Arbenz
|

|
|
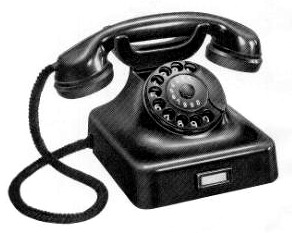
Einheitsfernsprecher der Deutschen Bundespost W 48
(Werksfoto Siemens & Halske 1956)
|
_________________________
[8] Sport-Toto war auch im damaligen Saarland schon eine sehr populäre Wettform auf den Ausgang
von Fußballspielen.
[9] Artikel 17: „Das Brief-,
Post-, Telegrafen- und Fernsprech- Geheimnis ist gewährleistet. Ausnahmen
bestimmt das Gesetz“; ein solches war im Saarland aber nie verabschiedet worden.
[10] Robert H. Schmidt, Saarpolitik 1945 – 1957, Berlin 1962, Band 1, S. 150 und:
Heinrich Schneider, Das Wunder an der Saar, Stuttgart 1974, S. 154.
[11]
In
Frankreich beträgt das Impulsverhältnis 2,0 zu 1, im Saarland wie in
ganz Deutschland 1,6 zu 1. Außerdem besitzen französische Apparate
einen automatischen Dämpfungsausgleich, während in Deutschland das
Prinzip der Kapselgruppierung gilt.
|
|